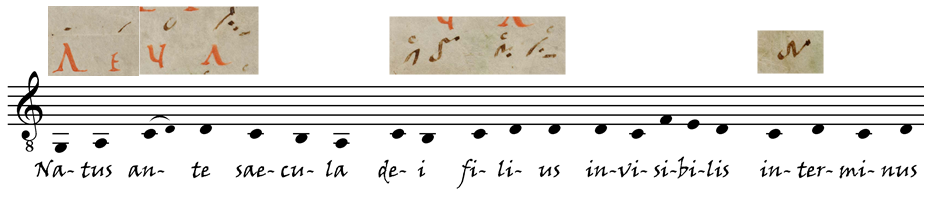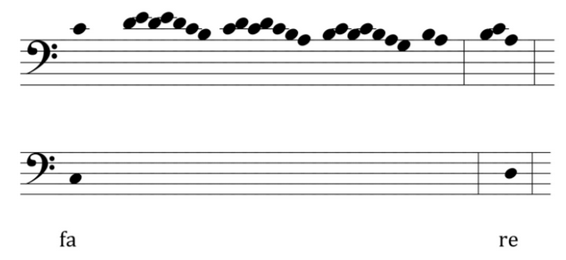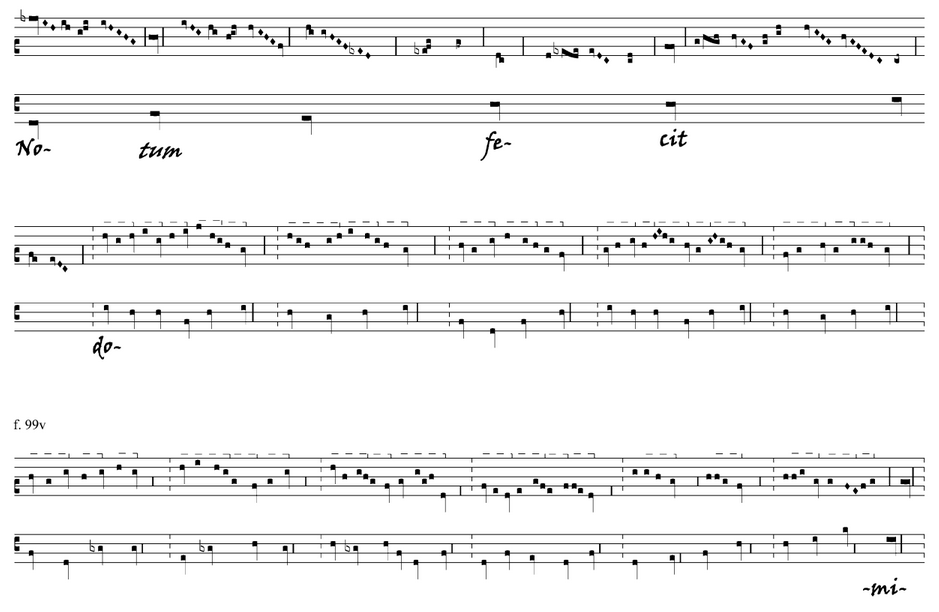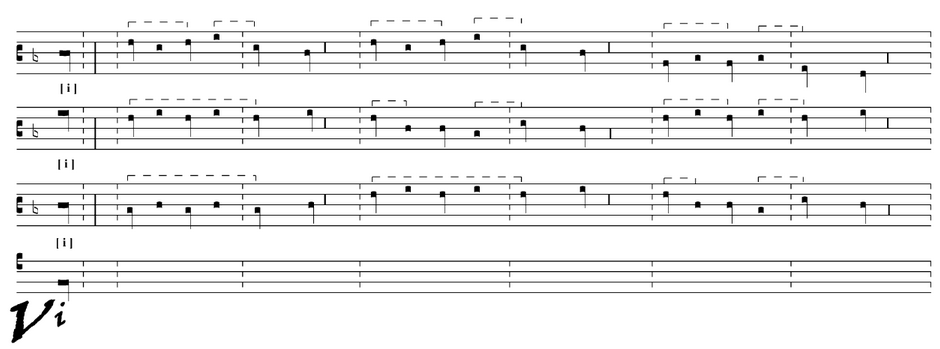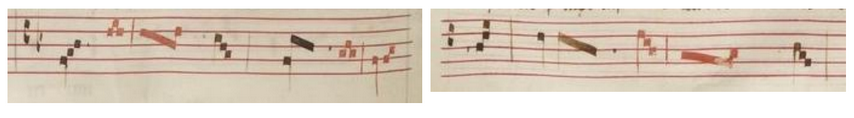Tropus und Sequenz
Bereits ein als Kanon der Synode von Meaux/Paris (845/846) überlieferter Text erwähnt »Erfindungen« (adinventiones, fictiones), und »Zusammenfügungen, die man Prosen nennt« (compositiones que prosas vocant), die manche Kleriker und Mönche aus »Freude am Neumodischen« (qui novitatibus delectati) im Gloria und in den melodischen Erweiterungen des Alleluias bei feierlichen Anlässen, den sequentiae, »hinzufügen, einschieben, aufsagen oder leise vor sich hin murmeln« (addere, interponere, recitare, submurmurare). Dies in der schändlichen Absicht, die reine, altehrwürdige Überlieferung (puritatem antiquitatis) zu durchsetzen (interpolare), weshalb es zu verurteilen sei und derjenige, der es dennoch tue, abgesetzt werden solle. Obwohl der genaue Zusammenhang dieses Textes mit der Synode unklar ist, liefert er doch interessante Informationen: Das Spannungsfeld zwischen althergebrachter Überlieferung (zu der offenbar auch bereits die sequentiae des Alleuias gehören) und den neuen Erweiterungen wird deutlich spürbar, sowohl in Hinblick auf die Texte, die ja bei diesen dichterischen Hinzufügungen neben den Hymnen zum ersten Mal nichtbiblischer Herkunft sind, als auch in Bezug auf die Melodien, die nicht der cantilena romana entstammen und sich von ihr hörbar emanzipieren können.
Schon das nicht mit Notation versehene Graduale von Mont Blandin (B-Br 10127-44 <https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&>, um 800) vermerkt zu sechs Alleluias (Beatus vir , Dominus regnavit , Iubilate deo , Te decet hymnus und die zusätzlichen Verse Laudamini in nomine, Notum fecit, f. 114v–115), dass sie mit Erweiterungen (cum sequentia) vorgetragen werden können. Hierunter sind melodische Zusätze zu verstehen, die den Iubilus des Alleluias bei seiner Wiederholung nach dem Vers ersetzten oder fortsetzen (lat. sequi, daraus abgeleitet sequentia) und erweiterten. Amalar von Metz spricht etwas später in seinen allegoretischen Erklärungen der Liturgie beim Alleluia davon, dass es mit einem Jubelgesang verbunden werde, den die Sänger sequentia nennen (iubilatio quam cantores sequentiam vocant, Liber officialis 3.16, um 823). Solche iubilationes oder sequentiae haben sich bei den Alleluias des Ambrosianischen Chorals als melodiae longissimae und auch im althispanischen Repertoire erhalten.
Ekkehard IV. von St. Gallen berichtet, der Mönch Tuotilo von St. Gallen habe Kaiser Karl III. bei dessen Besuch 883 in St. Gallen Tropen dargebracht. Darauf habe Karl Tuotilo beauftragt, solche Verse auch den vom Kaiser selbst verfassten offerendae hinzuzufügen. Solche prosulae zu Offertorien sind auch in den Handschriften vor allem zu den großen Melismen der Offertorienverse reichlich überliefert und Tuotilo werden einige Tropen zugeschrieben.
Die Erweiterungstechnik durch Hinzufügung eines neuen Text-Ton-Komplexes zu einem bereits existierenden Gesang findet sich besonders häufig beim Introitus, aber auch beim Offertorium und bei der Communio sowie bei Gloria, Sanctus und Agnus. Die einzelnen Tropierungen an verschiedenen Stellen des Primärgesangs, die bei den Ordinariumsgesängen meist als laudes, sonst als versus oder tropus bezeichnet sind, waren nicht fest mit diesem verbunden, sondern konnten auch zu anderen Gesängen wandern. Auch konnten die einzelnen Tropenelemente in verschiedenen Kombinationen auftreten. Zu den ältesten Tropen dieser Art gehören Gloria-Tropen, die ja bereits in dem Bericht aus Meaux genannt werden. Der Gloria-Tropus Quem vera pia laus wird zudem Hucbald von St. Amand zugeschrieben. Eine besondere Variante stellen hier sogenannte paraphrasierende Tropen dar, bei denen der Tropus den Text des Primärgesangs zu einer neuen Melodie aufgreift, so z.B. beim Tropus Dies sanctificatus (Tropus) zum Alleluia Dies sanctificatus , der in verschiedenen St. Galler Handschriften und ebenfalls in der Lorscher Handschrift (I-Rvat 485 <https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208> als Marginal-Eintrag auf f. 101v), im Winchester Tropar (GB-Ccc 473 <https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537> 473, f. 2v) sogar mit einer griechischsprachigen Variante im Wechsel überliefert ist. Paraphrasierende Tropen finden sich auch kombiniert mit der Aufforderung zur Ausführung des Gesangs als Einleitungstropen zum Offertorium.
Das älteste mit Notation versehene Tropar um 920 ist in der Handschrift F-Pn lat. 1240 aus St. Martial erhalten. Die älteste ostfränkische Tropensammlung (A-Wn 1609) aus dem frühen 10. Jahrhundert wurde in Freising nach St. Galler Vorlagen kopiert und enthält ca. 100 Tropen-Elemente für die Hauptfeste des Temporale, allerdings keine Tropen für das Sanktorale und keine der Tuotilo zugeschriebenen Tropen. Weitere frühe Tropensammlungen aus dem zweiten und dritten Viertel des 10. Jahrhunderts sind in den St. Galler Tropar-Sequentiaren CH-SGs 381 und 484 sowie in der Handschrift GB-Lbl add. 19768 aus St. Alban in Mainz erhalten.
Für die als prosa bezeichnete Technik der Textierung einer bestehenden Melodie ist wohl das älteste Zeugnis hierfür in einer Handschrift aus St. Emmeram (D-Mbs Clm 9543 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0004/bsb00042928/images/index.html?id=00042928&groesser=&fip=yztsxdsydxdsydenewqeayawxdsydewqen&no=14&seite=404>, f. 119v) überliefert. In ihr wurde der melismatische Vers des Alleluias Christus resurgens (GT 226–227) mit einer mit den Worten Psalle modulamina beginnenden Textierung, einer sogenannten prosula, versehen, die auf 830–840 datiert wird. Erkennbar wird hierbei, dass die Texte so gefasst wurden, dass sie die durch die Neumen vorgegebene Gliederung der Melodie berücksichtigen und versuchen, Assonanzen mit dem Trägerwort bzw. der Trägersilbe des Melismas zu erzeugen.
Alle drei Typen der Erweiterung zusammen finden sich besonders häufig beim Introitus, wie es etwa die St. Galler Tropare CH-SGs 484 und CH-SGs 381 aus dem zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts dokumentieren. Sie enthalten bis zu 30 verschiedene Kombinationen von Tropenelementen für denselben Introitus, die an verschiedenen Positionen der Introitus-Antiphon, des Verses und der Doxologie bzw. der Differentia auftreten können. Der Introitus eignete sich insofern besonders für die Tropierungspraxis, als er am Beginn der Messe bereits per se den Festtagsgedanken einleitend unterstreicht und die Introitus-Antiphon eigentlich selbst bereits einen Tropus zum Psalmvers bildet. Durch die Tropierung konnte diese Ausrichtung in Bezug auf das Festtagsgeheimnis noch unterstrichen werden. Im Gegensatz zur ostfränkischen Praxis beschränken sich meloforme Introitus-Tropen in der aquitanischen Tradition auf ein Melisma oder einen Melismenkomplex, tropieren selten die Introitus-Antiphon und erscheinen nicht in textierter Form. Da die ostfränkischen Quellen lange an der Notation in adiastematischen Neumen festhalten, kann der Melodieverlauf ihrer meloformen Tropen nur über spätere textierte Fassungen in Liniennotation, etwa in späteren deutschen oder norditalienischen Quellen gewonnen werden. Hier stellt sich auch die Frage, ob die Textierung solcher meloformer Tropen erst nachträglich erfolgte, also eigentlich im Sinne einer Tropierung eines bereits bestehenden Tropus. Oder ob diese von Anfang an wie bei den Kyrie-Tropen mit einem Text versehen waren, aber auch ohne Text verwendet wurden, zumal teilweise melismatische und textierte Fassung direkt hintereinander folgen. Offenbar waren die Grenzen zwischen den verschiedenen Tropierungspraktiken eher fließend. Für die Aufführungspraxis stellt sich die Frage, ob die textierte Fassung das Melisma ersetzte oder Melisma und Textierung hintereinander oder gar gleichzeitig gesungen wurden.
Einen der berühmtesten Einleitungs-Tropen bildet der auch von Ekkehard IV. erwähnte Tropus Hodie cantandus est des Tuotilo (CH-SGs 376 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510>, p. 39) zum Introitus der dritten Weihnachtsmesse Puer natus est . Die dialogische Struktur des Textes mit Frage und Antwort weist auf die Tendenz zur »Dramatisierung«, das Hodie auf die zur Aktualisierung im Hier und Jetzt der Tropen hin. Dabei greift Tuotilo wiederum das bereits in den liturgischen Gesängen an Weihnachten mehrfach erklingende Hodie auf (so im Introitus und Graduale der Vigil-Messe (GT 38–39) und in den Antiphonen und Responsorien der Matutin):
Tropus:
| Hodie cantandus est nobis puer | Heute müssen wir von dem Knaben singen, |
| quem gignebat ineffabiliter | den in tiefem Geheimnis |
| ante tempora pater | vor den Zeiten der Vater zeugte, |
| et eundem sub tempore | und diesen hat nun unter der Zeit |
| generavit inclita mater | die erhabene Mutter hervorgebracht. |
| Interrogatio: | Frage: |
| Quis est iste puer quem tam magnis | Wer ist dieser Knabe, den so großen |
| praeconiis dignum vociferatis? | Lobes würdig ihr verkündigt? |
| Dicite nobis, | Sagt es uns, |
| ut collaudatores esse possimus. | dass wir in dieses Lob miteinstimmen können |
| Responsio: | Antwort: |
| Hic enim est | Dieser ist es, |
| quem presagus et electus | den vorausahnend der erwählte |
| symmista dei | Mitwisser Gottes |
| ad terras venturum praevidens | in Vorschau, er komme auf Erden, |
| longe ante praenotavit | schon seit langem so geweissagt |
| sicque praedixit: | und prophezeit hat: |
| Introitus: | |
| Puer natus est nobis | Ein Knabe ist uns geboren |
| et filius datus est nobis | und ein Sohn ist uns geschenkt, |
| cuius imperium super humerum eius: | dessen Herrschaft auf seinen Schultern ruht. |
| Et vocabitur nomen eius | Und er wird genannt werden |
| magni consilii angelus | Engel des großen Rates. |
| Cantate Domino canticum novum | Singt dem Herrn ein neues Lied, |
| quia mirabilia fecit. | denn Wunderbares hat er getan. |
| Puer natus est … | Ein Knabe ist uns geboren ... |
(Übersetzung: Stefan Morent)
Die melodische Fassung von Tuotilos Weihnachtstropus unterstreicht dessen Aufbau. Auffällig ist jedoch, dass die Melodie des Tropus im D-Modus gehalten ist, während der Introitus im 7. Modus steht, was auf eine ursprünglich andere modale Fassung des Introitus hindeuten könnte.
Der Gregorius presul -Tropus ist nicht nur dem Introitus des ersten Adventssonntags einleitend vorangestellt, sondern leitet das gesamte Graduale und damit das Kirchenjahr programmatisch ein.
Im Stundengebet finden sich Tropen bei den Responsoria prolixa, bei den Marianischen Antiphonen wie dem Salve regina und beim Benedicamus Domino, dessen Tropierungen vor allem die Grundlage für mehrstimmige Bearbeitungen bilden. Amalar von Metz spricht von einem neuma triplex (Liber de ordine antiphonarii , 18.2), einer dreiteiligen, sich steigernden melodischen Erweiterung des letzten Responsoriums In medio ecclesiae am Fest des Evangelisten Johannes, das in das Responsorium Descendit de caelis an Weihnachten zu den Worten fabricae mundi übernommen wurde. Die dreimalige steigernde Erweiterung am Ende des Responsum-Teils ergibt sich durch dessen zweimalige Wiederholung beim jeweils letzten Responsorium der Nokturnen nach dem Vers und nach der Doxologie. In späteren Handschriften finden sich wiederum verschiedene Textierungen dieses neuma triplex, auch zu anderen Responsorien. Meloforme Tropen der Responsoria prolixa sind manchmal schwer zu identifizieren, da die Responsorien selbst schon hoch melismatisch ausgeführt sind. Prosulae finden sich bei den Responsoria prolixa ebenfalls nicht nur zu den ursprünglichen melismatischen Abschnitten, sondern auch zu meloformen Tropen und können sich zu sequenzartig strukturierten Gebilden mit Doppelversikeln entwickeln. Andere Tropen gleichen sich in Sprache und Melodik den Hymnen an oder übernehmen diese sogar.
Als »Ursprungsmythos« der Sequenz gilt Notkers Vorwort zu seiner 884/885 angelegten Sequenzensammlung, dem liber hymnorum (hymnus hier im Sinne von liturgischer Dichtung und vielleicht auch als Anklang an die Hymnen des Ambrosius und in Rückgriff auf Hieronymus, der das Psalmenbuch aus der hebräischen Bezeichnung als „Sephar Thallim” mit „Volumen hymnorum” übersetzt), zu dessen Kompilation er beim Besuch Karls III. in St. Gallen, bei dem auch Tuotilo den Auftrag zu Tropen erhielt, angeregt wird. Die frühesten erhaltenen Fragmente dieser Sammlung scheinen in den Handschriften CH-SGv 317 <http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108>, f. 13v-15r und F-Pn lat. 10587 vorzuliegen.
Das Verhältnis zum Alleluia ist auf verschiedenen Ebenen zu suchen: Frühe Sequenztexte enden oft in all ihren Teilen, den Versikeln, auf dem Vokal a, und einige frühe, sogenannte aparallele Sequenzen gehen in ihrer melodischen Vorlage tatsächlich auf ein existierendes Alleluia zurück. In wenigen Fällen lassen sich auch zumindest zu Beginn von Sequenzen Übereinstimmungen mit einem liturgischen Alleluia feststellen, so etwa bei Notkers Sequenz Stirpe Maria regia mit dem Alleluia Adducentur regi (GT 500). Die Nähe zum Alleluia kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Sequenz in der Messliturgie direkt auf das Alleluia folgt, den alten Gedanken der Erweiterung des Alleluia-Iubilus also auch hier weiter führt.
Die typische Versstruktur der auf Notker zurückgehenden Sequenzform besteht aus einem einzelnen Versikel zu Beginn und am Schluss, zwischen denen paarweise Parallelversikel mit der gleichen oder variierenden Silbenzahl und Melodie eingefügt sind, so dass die Sequenz als Ganzes dem Typ der fortschreitenden Repetition folgt. Die Schemata einiger sequentiae mit Silbenzahlen sind im Folgenden mit ihren Namen und der Seitenangabe im St. Galler Sequentiar CH-SGs 484 aufgeführt, wo die Neumenfolgen ohne Text merkwürdigerweise zeilenweise von unten nach oben zu lesen notiert wurden:
Concordia (p. 259) a16 b14b14 c17c17 d21d21 e21e21 f41f41 g19
Captiva (p. 278–277) a13 b18b18 c12c19 d23d27 e14e21 f18f18 g27g45 h25h25 i18i18 j16
Dies sanctificatus (Sequenz) (p. 258) a21a20 b18b18 c49c49 d23d23 e29e29 f27f27
Frigdola (p. 269–268) a15 b21b21 c43c43 d29d29 e37e37 f41f41 g12g12 h10h10 i31i31 j44j44 k26k29
Mater (p. 270) a16 b14b14 c17c17 d17d17 e36e35 f29f29 g34g34 h21h13 i13i22
Romana (p. 261) a14 b9b9 c18c18 d20d20 e18e18 f22f22 g19g19 h7
Teilweise sind die Textsilben in der Hauptspalte der ostfränkischen Sequentiare auch mit Einzeltonneumen versehen, die den in Einzeltöne aufgelösten Gruppenneumen entsprechen. Die Alleluiasilben weisen hierbei auf die textlose Melodie hin, werden aber auch von den Sequenz-Texten aufgenommen, indem sie die Vokale an den entsprechenden Stellen mit einbeziehen.
Bsp.: So eröffnet Notkers Liber ymnorum in der Handschrift CH-SGs 381 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0381/333/0/Sequence-513> (p. 333) mit seiner Weihnachtssequenz Natus ante saecula (Edition Crocker 1977, S. 234–238): In der Marginalspalte rechts ist das zugrunde liegende Melodiemodell Dies sanctificatus als Alleluia-Melisma mit den rot geschriebenen Vokalen A E U A in den ersten beiden Zeilen notiert. Dem entsprechen die ersten drei Worte des Sequentextes, NATUS in der ersten, und ANTE SAECULA in der zweiten Zeile. Durch die Schreibung dieser ersten drei Worte in Majuskeln wird noch deutlicher, wie Notker hier zu Beginn die Vokale A E U A in der Marginalspalte in seinem Text aufgreift. Die Neumenfolge in der Marginalspalte korrespondiert mit den Silben des Textes: NA-TUS entspricht der Folge Tractulus – Virga, die Liqueszenz zu AN- entspricht der durch den Epiphonus angezeigten Liqueszenz zu -[L]U[I]-, TE SAE-CU-LA entspricht dem viertönigen Climacus. Hier stimmen Wortgrenzen und Neumengruppen nicht überein, denn die zweite Silbe von ANTE kommt auf den ersten Ton des Climacus. Dessen Schreibung mit einem Episem zeigt aber die Wortgrenze an. In der dritten Zeile entspricht Dei filius der Neumenfolge Clivis – Pes stratus , invisibilis der Neumenfolge Pressus minor – dreitöniger Climacus, in der vierten Zeile Interminus dem Torculus resupinus. Dessen letzter Ton ist mit einem Episem versehen, was auf eine Betonung der Endartikulation besonders am Versikelende bei den Sequenzen hindeutet:
Beginn von Notkers Weihnachtssequenz Natus ante saecula: Neumen CH-SGs 381, p. 333 (Tonhöhenrekonstruktion: Stefan Morent nach verschiedenen Handschriften mit Liniennotation).
West- und ostfränkische Sequenzenrepertoires unterscheiden sich ziemlich klar: Kommt dieselbe Melodie in beiden Repertoires vor, so fast immer mit verschiedenem Text und Varianten der Melodie. Auch in der Aufzeichnungsweise zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Im Gegensatz zur synoptischen Aufzeichnungsweise ostfränkischer Sequentiare zeichnen westfränkische Handschriften die Melodien (sequentia) und die dazugehörigen Texte (prosa) getrennt und an verschiedenen Stellen der Handschrift auf. Nur im westfränkischen Repertoire erscheinen teiltextierte sequentiae, bei denen nur einzelnen Abschnitte der Melodie textiert sind. Einen weiteren Sonderfall der Gattung Sequenz bilden Sequenzen wie Rex caeli mit sogenanntem doppeltem Cursus, bei denen einzelne Versikel-Folgen melodisch selbst noch einmal wiederholt werden. Zu den wenigen in beiden Repertoires überlieferten Sequenzen gehört Notkers berühmte Pfingstsequenz Sancti spiritus assit nobis gratia (Edition Crocker 1977, S. 200–201). Notkers Sequenzensammlung in seinem Liber hymnorum bildete im ostfränkischen Bereich über Jahrhunderte den Grundstock des Sequenzbestandes.
Als älteste notierte Sequenzen gelten die drei textlosen Melodien und zwei teilweise textierten Sequenzmelodien (Adorabo minor mit Textierung Suscipe laus angelorum und Fulgens preclara mit Textierung Rex in eternum) in der Handschrift F-Pn lat. 17436, f. 29r-30r, die dem zwischen 860 und 877 in Soissons für Compiègne geschriebenen Gradual-Antiphonar vor dem Ende des 9. Jahrhunderts hinzugefügt wurden (auf f. 24r Nachtrag der neumierten Sequenz Summa pia vom Ende des 9. Jh.).
Audio/Video
Tuotilo: Tropus Hodie cantandus est, Notker: Sequenzen Natus ante saecula, Sancti spiritus
Quellen
Sequenzen aus St. Victor: F-Pn lat. 14819
Sequenz Summa pia in F-Pn lat. 17436
Quellentexte und Editionen
Ostersequenz Victimae paschali laudes: GT 198–199
Pfingstsequenz Veni sancte spiritus: GT 253–254
Sequenz der Totenmesse Dies irae: LU 1810–1813
Sequenz am Fest der Sieben Schmerzen Mariens Stabat mater: GT 602–605
Fronleichnamssequenz Lauda Sion: GT 379–383
Hanssens, Jean Michel (Hrsg.), „Amalar von Metz: Liber de ordine antiphonarii“ in: Amalarii episcopi Opera liturgica omnia 3 , Rom 1950.
@incollection{.1950, title = {Amalar von Metz: Liber de ordine antiphonarii}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, editor = {Hanssens, Jean Michel}, booktitle = {Amalarii episcopi Opera liturgica omnia 3}, year = {1950}, address = {Rom} }Hughes, Anselm, Anglo-French sequelae, London 1934.
@book{AFsHughes, author = {Hughes, Anselm}, year = {1934}, title = {Anglo-French sequelae}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {London} }Bower, Calvin M. (Hrsg.), The Liber ymnorum of Notker Balbulus, Woolbridge 2016.
@book{Bower.2016, year = {2016}, title = {The Liber ymnorum of Notker Balbulus}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Woolbridge}, editor = {Bower, Calvin M.} }Notker Balbulus, Sequenzen. Ausgabe für die Praxis. Eingerichtet von Stefan Morent, übersetzt von Franziska Schnoor und Clemens Müller, hg. von der Stiftsbibliothek St. Gallen, St. Gallen and St, Ottilien 2017.
@book{NBSAfdPEvSMuvFSuCMhvdSSG, year = {2017}, title = {Notker Balbulus, Sequenzen. Ausgabe f{\"u}r die Praxis. Eingerichtet von Stefan Morent, {\"u}bersetzt von Franziska Schnoor und Clemens M{\"u}ller, hg. von der Stiftsbibliothek St. Gallen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {St. Gallen and St, Ottilien} }Rüsch, Ernst Gerhard (Hrsg.), Gaudete et cantate. Seid fröhlich und singet. Tropen aus den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen, St. Gallen 1990.
@book{Rusch.1990, year = {1990}, title = {Gaudete et cantate. Seid fr{\"o}hlich und singet. Tropen aus den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {St. Gallen}, editor = {R{\"u}sch, Ernst Gerhard} }Crocker, Richard, The early medieval sequence, Berkeley 1977.
@book{TemsCrocker, author = {Crocker, Richard}, year = {1977}, title = {The early medieval sequence}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Berkeley} }Evans, Paul, The early trope repertory of Saint Martial de Limoges, Princeton 1970.
@book{TetroSMdLEvans, author = {Evans, Paul}, year = {1970}, title = {The early trope repertory of Saint Martial de Limoges}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Princeton} }Goede, Nikolaus de, The Utrecht prosarium, Amsterdam 1965.
@book{TUpGoede, author = {de Goede, Nikolaus}, year = {1965}, title = {The Utrecht prosarium}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Amsterdam} }Moberg, Carl A., Über die schwedischen Sequenzen, Freiburg (Schweiz) 1927.
@book{UdsSMoberg, author = {Moberg, Carl A.}, year = {1927}, title = {{\"U}ber die schwedischen Sequenzen}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Freiburg (Schweiz)} }Weiß, Günther (Hrsg.), Introitus-Tropen I: Das Repertoire der südfranzösischen Tropare des 10. und 11. Jahrhunderts (Monumenta Monodica Medii Aevi), Kassel 1970.
@book{Wei.1970, year = {1970}, title = {Introitus-Tropen I: Das Repertoire der s{\"u}dfranz{\"o}sischen Tropare des 10. und 11. Jahrhunderts}, keywords = {Quellentexte;TropusUndSequenz}, address = {Kassel}, volume = {3}, series = {Monumenta Monodica Medii Aevi}, editor = {Wei{\ss}, G{\"u}nther} }
Handschriften
A-Wn 1609.
@book{AW1b, title = {A-Wn 1609}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }B-Br 10127-44 <https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&>
@book{BB14, title = {B-Br 10127-44}, url = {https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9417610&}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGv 317 <http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108>
@book{CS3i, title = {CH-SGv 317}, url = {http://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0317/13v/0/Sequence-1108}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGs 376 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510>
@book{CS3j, title = {CH-SGs 376}, url = {http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0376/39/0/Sequence-510}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }CH-SGs 484 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567>
@book{CS3u4, title = {CH-SGs 484}, url = {http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }F-Pn lat. 10587.
@book{FPl1, title = {F-Pn lat. 10587}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }F-Pn lat. 1240.
@book{FPl1g, title = {F-Pn lat. 1240}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }GB-Ccc 473 <https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537>
@book{GC4b, title = {GB-Ccc 473}, url = {https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }GB-Lbl add. 19768.
@book{GLa1, title = {GB-Lbl add. 19768}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }I-Rvat 485 <https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208>
@book{IR4, title = {I-Rvat 485}, url = {https://doi.org/10.11588/diglit.4497#0208}, keywords = {Handschriften;TropusUndSequenz} }
Faksimilia
Arlt, Wulf und Susan Rankin (Hrsg.), Stiftsbibliothek Sankt Gallen Codices 484 & 381, Winterthur 1996.
@book{Arlt.1996, year = {1996}, title = {Stiftsbibliothek Sankt Gallen Codices 484 {\&} 381}, keywords = {Faksimilia;TropusUndSequenz}, address = {Winterthur}, editor = {Arlt, Wulf and {Susan Rankin}} }
Literatur
Arlt, Wulf, „Komponieren im Galluskloster um 900: Tuotilos Tropen Hodie cantandus est zur Weihnacht und Quoniam dominus Iesus Christus zum Fest des Iohannes evangelista“ in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft Neue Folge 15, 1995, S. 41–70.
@article{Arlt.1995, author = {Arlt, Wulf}, year = {1995}, title = {Komponieren im Galluskloster um 900: Tuotilos Tropen Hodie cantandus est zur Weihnacht und Quoniam dominus Iesus Christus zum Fest des Iohannes evangelista}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {41--70}, volume = {Neue Folge 15}, journal = {Schweizer Jahrbuch f{\"u}r Musikwissenschaft} }Bower, Calvin M., „From Alleluia to Sequence. Some Definitions of Relations“ in: Sean Gallagher (Hrsg.), Western plainchant in the first millennium. Studies in the medieval liturgy and its music , Aldershot 2003, S. 351–428.
@incollection{Bower.2003, author = {Bower, Calvin M.}, title = {From Alleluia to Sequence. Some Definitions of Relations}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {351--428}, editor = {Gallagher, Sean}, booktitle = {Western plainchant in the first millennium. Studies in the medieval liturgy and its music}, year = {2003}, address = {Aldershot} }Colette, Marie-Noel, „Séquences et versus ad sequentias dans l’antiphonaire de Charles le Chauve (Paris, BnF lat. 17346)“ in: Revue de Musicologie 80, 2003, S. 5–29.
@article{Colette.2003, author = {Colette, Marie-Noel}, year = {2003}, title = {S{\'e}quences et versus ad sequentias dans l'antiphonaire de Charles le Chauve (Paris, BnF lat. 17346)}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {5--29}, volume = {80}, journal = {Revue de Musicologie} }Crocker, Richard, „The troping hypothesis“ in: Musical Quaterly 52, 1966, S. 183–203.
@article{Crocker.1966, author = {Crocker, Richard}, year = {1966}, title = {The troping hypothesis}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {183--203}, volume = {52}, journal = {Musical Quaterly} }Husmann, Heinrich, „Sequenz und Prosa“ in: Annales Musicologiques ( 61-91) 2/61-91, 1954.
@article{Husmann.1954b, author = {Husmann, Heinrich}, year = {1954}, title = {Sequenz und Prosa}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, volume = {2}, number = {61-91}, journal = {Annales Musicologiques} }———, „Sinn und Wesen der Tropen veranschaulicht an den Introitustropen des Weihnachtsfestes“ in: Archiv für Musikwissenschaft 16, 1959, S. 135–147.
@article{Husmann.1959, author = {Husmann, Heinrich}, year = {1959}, title = {Sinn und Wesen der Tropen veranschaulicht an den Introitustropen des Weihnachtsfestes}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {135--147}, volume = {16}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Kelly, Thomas Forrest, „Neuma triplex“ in: Acta Musicologica 60, 1988, S. 1–30.
@article{Kelly.1988, author = {Kelly, Thomas Forrest}, year = {1988}, title = {Neuma triplex}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {1--30}, volume = {60}, journal = {Acta Musicologica} }Kurckenberg, Lori, „Neumatizing the sequence. Special perfomances of sequences in the central Middle Ages“ in: Journal of the American Musicological Society 59, 2006, S. 243–327.
@article{Kurckenberg.2006, author = {Kurckenberg, Lori}, year = {2006}, title = {Neumatizing the sequence. Special perfomances of sequences in the central Middle Ages}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {243--327}, volume = {59}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Stäblein, Bruno, „Zur Frühgeschichte der Sequenz“ in: Archiv für Musikwissenschaft 18, 1961, S. 1–33.
@article{Stablein.1961, author = {St{\"a}blein, Bruno}, year = {1961}, title = {Zur Fr{\"u}hgeschichte der Sequenz}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {1--33}, volume = {18}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }———, „Der Tropus ’Dies sanctificatus’ zum Alleluia ’Dies sanctificatus’“ in: Festschrift für Erich Schenk (Studien zur Musikwissenschaft: Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich), Graz u.a. 1962, S. 504–515.
@incollection{Stablein.1962, author = {St{\"a}blein, Bruno}, title = {Der Tropus 'Dies sanctificatus' zum Alleluia 'Dies sanctificatus'}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {504--515}, series = {Studien zur Musikwissenschaft: Beihefte der Denkm{\"a}ler der Tonkunst in {\"O}sterreich}, booktitle = {Festschrift f{\"u}r Erich Schenk}, year = {1962}, address = {Graz u.a.} }———, „Notkeriana“ in: Archiv für Musikwissenschaft 19/20, 1962/1963, S. 84–99.
@article{Stablein.19621963, author = {St{\"a}blein, Bruno}, year = {1962/1963}, title = {Notkeriana}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {84--99}, volume = {19/20}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Hospenthal, Cristina, Tropen zum Ordinarium missae in St. Gallen. Untersuchungen zu den Beständen in den Handschriften St. Gallen, Stiftsbibliothek 381, 484, 376, 378, 380 und 382 (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Société suisse de musicologie Ser. 2), Bern and New York 2010.
@book{TzOmiSGUzdBidHSGS34333u3Hospenthal, author = {Hospenthal, Cristina}, year = {2010}, title = {Tropen zum Ordinarium missae in St. Gallen. Untersuchungen zu den Beständen in den Handschriften St. Gallen, Stiftsbibliothek 381, 484, 376, 378, 380 und 382}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, address = {Bern and New York}, volume = {52}, series = {Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Soci{\'e}t{\'e} suisse de musicologie Ser. 2} }Wälli, Sylvia, „Notkers Sequenz-Melodien des 9. Jahrhunderts. Aspekte der Rekonstruktion und Rezeption am Beispiel von Natus ante saecula“ in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft Neue Folge 23, 2003, S. 35–118.
@article{Walli.2003, author = {W{\"a}lli, Sylvia}, year = {2003}, title = {Notkers Sequenz-Melodien des 9. Jahrhunderts. Aspekte der Rekonstruktion und Rezeption am Beispiel von Natus ante saecula}, keywords = {Literatur;TropusUndSequenz}, pages = {35--118}, volume = {Neue Folge 23}, journal = {Schweizer Jahrbuch f{\"u}r Musikwissenschaft} }
Dramatisierungen der Liturgie
Die bereits an Tuotilos Weihnachtstropus beobachtete dialogische Struktur wurde auch auf andere biblische Szenen angewendet und konnte dadurch eine Dramatisierung der Liturgie bewirken. Als ältester dieser Dialoge gilt die Szene des Ostermorgens mit den drei Frauen und dem Engel am Grab nach Mk 16,1–7 mit folgendem dreizeiligem Dialog, so etwa im St. Galler Tropar CH-SGs 484 <http://e-codices.unifr.ch/en/csg/0484/111/0/Sequence-567>, p. 111, dessen Neumierung mithilfe späterer Parallelüberlieferung in Tonhöhen rekonstruiert werden kann:
[Angelus] Int[errogatio]: Quem queritis in sepulchro [o] Christicole
[Mulieres] R[esponsum]: Ihesum Nazarenum crucifixum o caelicolae
[Angelus]Non est hic surrexit sicut predixerat. Ite nuntiate quia surrexit de sepulchro
[Engel]: Wen sucht ihr im Grab, ihr Christinnen?
[Frauen] Antwort: Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten, o ihr Himmlischen.
[Engel]: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er vorher gesagt hatte. Geht und kündet, dass er vom Grabe auferstanden ist.
Quem que- ri- tis in se-pul-chro [o] Chri-sti-co-le
Ihe-sum Na-za-re-num cru-ci-fi- xum o cae-li-co-lae
Non est hic sur-re-xit si-cut pre-di-xe- rat
i-te nun- ti- a-te qui-a sur- re-xit de se-pul-chro
(Transkription: Stefan Morent)
Nach dem Vorbild des Quem queritis-Dialogs bildet sich ein ähnlicher Dialog für das Weihnachtsgeschehen heraus, mit der Frage Quem queritis in presepe pastores dicite (»Wen sucht ihr in der Krippe, ihr Hirten, sagt an«) der Engel an die Hirten. Der ursprüngliche Vorbildcharakter des Ostergeschehens am Beginn der Ausbildung dramatischer Gestaltung in der liturgischen Musik bleibt auch in der weiteren Musikgeschichte erhalten: Während für das Mysterium von Passion und Auferstehung über die Jahrhunderte zahlreiche dramatische und satztechnisch anspruchsvolle Kompositionen entstehen, herrscht in der Musik zur Weihnacht traditionell das pastorale Element der Volkstümlichkeit und Einfachheit bzw. künstlichen Einfachheit vor.
Der Quem queritis-Dialog erscheint in verschiedenen Funktionen: Im Kontext der einleitenden Prozession vor der Messe am Ostersonntag, als Tropus zum Introitus Resurrexi (GT 196) der Ostermesse oder nach dem letzten Responsorium Dum transisset sabbatum der Matutin vor dem Te Deum am Ostermorgen. Später wird er durch Antiphonen und weitere tropierende Zusätze erweitert und ist als einer der wenigen Tropen häufig in west- und ostfränkischen Handschriften gleichermaßen belegt. Alles deutet darauf hin, dass er im 9. Jahrhundert im ostfränkischen Gebiet entstanden ist. Am Ende der Matutin wurde dieser Dialog zu einer rituellen Darstellung des Grabbesuches ausgedehnt, der in der Forschung als Visitatio Sepulchri bezeichnet wird. Dies korrespondiert mit rituellen Erweiterungen der Liturgie des Karfreitags und des Karsamstags, die zur Veranschaulichung und Intensivierung des in der Liturgie gefeierten Heilsgeschehens dienen: Die Grablegung des Heiligen Kreuzes am Karfreitag (Depositio crucis ) und die Erhebung des Kreuzes in der Osternacht (Elevatio crucis ).
Die Forschung hat die verschiedenen Überlieferungsformen der Visitatio Sepulchri in drei Stufen eingeteilt, die aber nicht einer chronologischen Entwicklung entsprechen, sondern verschiedene gleichzeitige Ausarbeitungen benennen. So tritt zur Begegnung der Frauen mit dem Engel (Typ I) in Typ II der sogenannte Jüngerlauf (Joh 20,3–10) mit Petrus und Johannes hinzu, bei dem die beiden Jünger, nachdem die Marien von ihrer Begegnung mit dem Engel berichtet haben, zum Grab eilen und Johannes als der schnellere von beiden als erster in das Grab hinein geht. Neu hinzu kommen hier auch die Antiphonen Ad monumentum venimus und Quis revolvit nobis lapidem als Gesang der Marien auf dem Weg zum Grab, die Offiziums-Antiphon Currebant duo simul für den Jüngerlauf und die Antiphon Cernitis o socii für die Präsentation der leeren Leinenbinden. Typ III ist durch die sogenannte Hortulanus -Szene (Joh 20,11–17) charakterisiert, der Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen, den sie zunächst für einen Gärtner hält. Als weitere Szene tritt die Salbenkrämer-Szene hinzu, die in späteren Fassungen auch volkssprachliche Anteile mit in die Visitatio einbringt. Mit der Visitatio verbunden wird in vielen Handschriften die Sequenz Victimae pachali laudes, die selbst bereits einen Dialog mit Maria Magadalena enthält.
Bei der dramatischen Ausgestaltung der Karfreitagsliturgie tritt neben die Sequenz Planctus ante nescia die Sequenz Flete fideles animae aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, die die unter dem Kreuz Stehenden zur Beweinung aufruft.
In Bezug auf die in adiastematischen deutschen Neumen notierten Melodien der Carmina burana-Handschrift (D-Mbs clm 4660/4660a <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb00085130>) ergeben sich folgende Szenarien für ihre Rekonstruktion in Tonhöhen, die allgemein für die Überlieferung der geistlichen Spiele gelten: Die liturgischen Gesänge lassen sich meist durch eine spätere Parallelüberlieferung zumindest annäherungsweise rekonstruieren, dies gilt auch für die weiter verbreiteten Gesänge, insofern sie später oder parallel auf Linien notiert wurden. Für die Eigengesänge ist meist nur eine relative, hypothetische Rekonstruktion des Melodieverlaufs möglich.
Obwohl sich die Begriffe »Geistliches Spiel « und »Liturgisches Drama« in der Forschung eingebürgert haben, ziehen neuere Ansätze das Konzept der Zeremonie bzw. der rituellen Darstellung vor, um einengende Konnotationen mit wesentlich späteren Gattungen wie »(Schau-)Spiel«, »Theater« und »Drama«, aber auch mit Begriffen wie »Aufführung« und »Publikum« zu vermeiden und den nicht klar abgrenzbaren Erscheinungsformen von dramatisierenden Elementen in der Liturgie eher gerecht zu werden. In den Handschriften selbst finden sich die Bezeichungen ordo , officium, ludus , festum , miraculum , misterium und *repraesentatio *. In der weiteren Entwicklung treten ab dem späten 11. Jahrhundert auch Stoffe auf, die nicht-biblischen Urprungs sind, wie z.B. die Mirakelspiele um den Hl. Nikolaus.
Eine Sonderstellung nimmt das Mysterienspiel Ordo virtutum (= Spiel der Kräfte oder Reigen der Tugendkräfte, Edition Lieder S. 165–205) von Hildegard von Bingen (1098–1179) ein, das weder auf eine konkrete biblische Grundlage noch auf Legenden- oder Mirakelstoffe zurück zu führen ist, sondern den Entscheidungsweg der menschlichen Seele (anima) zwischen den guten Kräften (virtutes) und den Verlockungen des Teufels schildert. Am ehesten ließen sich Parallelen zu eschatologischen Spielen des 11. und 12. Jahrhunderts finden, wie dem französischen Sponsus-Spiel (Spiel von den klugen und törichten Jungfrauen) oder dem Tegernseer Antichrist-Spiel. Mit ihnen hat der Ordo zumindest die Thematik der endzeitlichen Entscheidung zwischen dem göttlich-heilenden und dem teuflisch-verderbenden Prinzip gemeinsam. Der Schauplatz der menschlichen Seele, deren innere Entscheidungskämpfe personifiziert und anschaulich nach außen transportiert werden, steht als Spielinhalt des Ordo jedoch einzigartig da und findet sich erst bei den Moralitätenspielen späterer Zeit wieder. Er nahm vermutlich in der klösterlichen Gemeinschaft Hildegards auf dem Rupertsberg die Funktion eines Rituals ein, das den Nonnen die theologischen Anschauungen ihrer magistra leibseelisch und multimedial vermitteln sollte. Überliefert ist der Ordo am Ende der Sammlung von Hildegards Kompositionen im sogenannten Wiesbadener »Riesencodex « (D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620> f. 478ra–481vb, um 1180).
Ein Beispiel für eine Sammlung geistlicher Spiele stellt die Handschrift F-O (Orléans, Biblioteque Municipale), Ms. 201 aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts aus Fleury dar. Sie enthält Spiele um die Legenden des Hl. Nikolaus, ein Magierspiel, ein Peregrinusspiel, die Bekehrung des Paulus, ein Spiel um Herodes und die Unschuldigen Kinder , ein Spiel um die Auferweckung des Lazarus sowie eine Visitatio. Die Melodien sind auf Linien notiert.
In den Kontext satirischer Elemente im Geistlichen Spiel gehört die »Spielermesse« (officium lusorum der Carmina burana-Handschrift (f. 93v–94v), die den Messablauf in satirischer und teilweise derber Absicht parodiert und verballhornt. Die frühesten Quellen für das Narrenfest mit lesbaren Melodien finden sich in der Handschrift GB-Lbl (London, British Library), Egerton 2615 aus Beauvais mit dem berühmten »Esels«-Conductus Orientis partibus und F-SEm (Sens, Bibliothèque Municipale) Hs. 4, beide aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Quellentexte und Editionen
Barth, Pudentia u. a. (Hrsg.), Hildegard von Bingen. Lieder, Salzburg 1969.
@book{Barth.1969, year = {1969}, title = {Hildegard von Bingen. Lieder}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Salzburg}, editor = {Barth, Pudentia and Ritscher, Immaculata and Schmidt-G{\"o}rg, Joseph} }Corrigan, Vincent (Hrsg.), Hildegard of Bingen: Ordo Virtutum. A Comparative Edition, Lions Bay 2013.
@book{Corrigan.2013, year = {2013}, title = {Hildegard of Bingen: Ordo Virtutum. A Comparative Edition}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Lions Bay}, editor = {Corrigan, Vincent} }Coussemaker, Edmond de (Hrsg.), Drames liturgiques du moyen âge (texte et musique), Paris 1861.
@book{Coussemaker.1861, year = {1861}, title = {Drames liturgiques du moyen {\^a}ge (texte et musique)}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Paris}, editor = {de Coussemaker, Edmond} }Davidson, Audrey E. (Hrsg.), The \glqOrdo virtutum’ of Hildegard von Bingen, Kalamazoo 1985.
@book{Davidson.1985, year = {1985}, title = {The {\glq}Ordo virtutum' of Hildegard von Bingen}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Kalamazoo}, editor = {Davidson, Audrey E.} }Dronke, Peter (Hrsg.), Nine Medieval Latin Plays, Cambridge 1994.
@book{Dronke.1994, year = {1994}, title = {Nine Medieval Latin Plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Cambridge}, editor = {Dronke, Peter} }Fletcher, Collins (Hrsg.), Medieval church music-dramas. A repertory of complete plays, Charlottesville 1976.
@book{Fletcher.1976, year = {1976}, title = {Medieval church music-dramas. A repertory of complete plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Charlottesville}, editor = {Fletcher, Collins} }Greenberg, Noah und Smoldon William L. (Hrsg.), The Play of Herod, Oxford 1965.
@book{Greenberg.1965, year = {1965}, title = {The Play of Herod}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Oxford}, editor = {Greenberg, Noah and {Smoldon William L.}} }Hennig, Ursula und Andreas Traub (Hrsg.), Trierer Marienklage und Osterspiel. Codex 1973/63 der Stadtbibliothek Trier, Göppingen 1990.
@book{Hennig.1990, year = {1990}, title = {Trierer Marienklage und Osterspiel. Codex 1973/63 der Stadtbibliothek Trier}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {G{\"o}ppingen}, editor = {Hennig, Ursula and Traub, Andreas} }Kühl, Gustav, „Bordesholmer Marienklage“ in: Niederdeutsches Jahrbuch 27, 1893, S. 1–75.
@article{Kuhl.1893, author = {K{\"u}hl, Gustav}, year = {1893}, title = {Bordesholmer Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, pages = {1--75}, volume = {27}, journal = {Niederdeutsches Jahrbuch} }Lipphardt, Walter (Hrsg.), Die Weisen der lateinischen Osterspiele des 12. und 13. Jahrhunderts, Kassel 1948.
@book{Lipphardt.1948, year = {1948}, title = {Die Weisen der lateinischen Osterspiele des 12. und 13. Jahrhunderts}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Kassel}, editor = {Lipphardt, Walter} }——— (Hrsg.), Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Teil II–V, Visitatio sepulchri, Berlin and New York 1976.
@book{Lipphardt.1976, year = {1976}, title = {Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Teil II--V, Visitatio sepulchri}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Berlin and New York}, editor = {Lipphardt, Walter} }Ricossa, Luca (Hrsg.), Hildegard von Bingen: Ordo Virtutum, o. O. 2013.
@book{Ricossa.2013, year = {2013}, title = {Hildegard von Bingen: Ordo Virtutum}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {o. O.}, editor = {Ricossa, Luca} }Schönemann, Otto (Hrsg.), Der Sündenfall und Marienklage. Zwei niederdeutsche Schauspiele aus Handschriften der Wolfenbüttler Bibliothek, Hannover 1855.
@book{Schonemann.1855, year = {1855}, title = {Der S{\"u}ndenfall und Marienklage. Zwei niederdeutsche Schauspiele aus Handschriften der Wolfenb{\"u}ttler Bibliothek}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Hannover}, editor = {Sch{\"o}nemann, Otto} }Smoldon William L. (Hrsg.), The play of Daniel, London 1960.
@book{SmoldonWilliamL..1960, year = {1960}, title = {The play of Daniel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {London}, editor = {{Smoldon William L.}} }Symos, Thomas (Hrsg.), Regularis concordia Anglicae nationis monachorum sanctimonialiumque/The monastic agreement of the monks and nuns of the English nation, London 1953.
@book{Symos.1953, year = {1953}, title = {Regularis concordia Anglicae nationis monachorum sanctimonialiumque/The monastic agreement of the monks and nuns of the English nation}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {London}, editor = {Symos, Thomas} }Tintori, Giampiero und Raffaello Monterosso (Hrsg.), Sacre rappresentazioni nel manoscritto 201 della Bibliothèque municipale di Orléans, testi e musiche trascritti e commentati (Instituta et monumenta), Cremona 1958.
@book{Tintori.1958, year = {1958}, title = {Sacre rappresentazioni nel manoscritto 201 della Biblioth{\`e}que municipale di Orl{\'e}ans, testi e musiche trascritti e commentati}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Cremona}, volume = {2}, series = {Instituta et monumenta}, editor = {Tintori, Giampiero and Monterosso, Raffaello} }Welker, Lorenz (Hrsg.), Hildegard. Lieder. Faksimile Riesencodex (Hs. 2) der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, fol. 466–481v (Elementa musicae), Wiesbaden 1998.
@book{Welker.1998, year = {1998}, title = {Hildegard. Lieder. Faksimile Riesencodex (Hs. 2) der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, fol. 466--481v}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Wiesbaden}, volume = {1}, series = {Elementa musicae}, editor = {Welker, Lorenz} }Wyndham, Thomas (Hrsg.), The Fleury Playbook I: four twelvth-century Saint Nicholas liturgical dramas, Moretonhamstead 1998.
@book{Wyndham.1998, year = {1998}, title = {The Fleury Playbook I: four twelvth-century Saint Nicholas liturgical dramas}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Quellentexte}, address = {Moretonhamstead}, editor = {Wyndham, Thomas} }
Faksimilia
Handschriften
D-KIu Cod. Bord. mscr. 53 <http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-1222713>
@book{DKCBm5, title = {D-KIu Cod. Bord. mscr. 53}, url = {http://dibiki.ub.uni-kiel.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:gbv:8:2-1222713}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-Mbs clm 4660/4660a.
@book{DMc44, title = {D-Mbs clm 4660/4660a}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-Mbs lat. 19411.
@book{DMl1, title = {D-Mbs lat. 19411}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-W Cod. helmst 965 <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/965-helmst&pointer=0>
@book{DWCh9, title = {D-W Cod. helmst 965}, url = {http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/965-helmst&pointer=0}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620>
@book{DWH2, title = {D-WIl Hs. 2}, url = {https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }F-O Ms. 201.
@book{FOM2, title = {F-O Ms. 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }F-SEm Hs. 4.
@book{FSH4, title = {F-SEm Hs. 4}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }GB-Lbl Egerton 2615.
@book{GLE2, title = {GB-Lbl Egerton 2615}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Handschriften} }
Literatur
Abert, Anna Amalie, „Das Nachleben des Minnesangs im liturgischen Spiel“ in: Die Musikforschung 1, 1948, S. 95–105.
@article{Abert.1948, author = {Abert, Anna Amalie}, year = {1948}, title = {Das Nachleben des Minnesangs im liturgischen Spiel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {95--105}, volume = {1}, journal = {Die Musikforschung} }Bernard, Madeleine, „L’officium stellae Nivernais“ in: Revue de Musicologie 51, 1965, S. 52–65.
@article{Bernard.1965, author = {Bernard, Madeleine}, year = {1965}, title = {L'officium stellae Nivernais}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {52--65}, volume = {51}, journal = {Revue de Musicologie} }Binkles, Thomas, „The Greater Passion Play from the Carmina Burana. An introduction“ in: Peter Reidemeister und Veronika Gutmann (Hrsg.), Alte Musik. Praxis und Reflexion , Winterthur 1983, S. 144–157.
@incollection{Binkles.1983, author = {Binkles, Thomas}, title = {The Greater Passion Play from the Carmina Burana. An introduction}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {144--157}, editor = {Reidemeister, Peter and Gutmann, Veronika}, booktitle = {Alte Musik. Praxis und Reflexion}, year = {1983}, address = {Winterthur} }Bowles, Edmund A., „The role of musical instruments in medieval sacred church drama“ in: Musical Quaterly 45, 1959, S. 67–84.
@article{Bowles.1959, author = {Bowles, Edmund A.}, year = {1959}, title = {The role of musical instruments in medieval sacred church drama}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {67--84}, volume = {45}, journal = {Musical Quaterly} }Brewer, Charles E., „The web of sources for Planctus ante nescia“ in: Cantus Planus. Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria 2011 , Wien 2012, S. 72–77.
@incollection{Brewer.2012, author = {Brewer, Charles E.}, title = {The web of sources for Planctus ante nescia}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {72--77}, booktitle = {Cantus Planus. Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria 2011}, year = {2012}, address = {Wien} }Campell, Thomas P. und Clifford Davidson (Hrsg.), The Fleury Playbook. Essays and studies, Kalamazoo 1985.
@book{Campell.1985, year = {1985}, title = {The Fleury Playbook. Essays and studies}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Kalamazoo}, editor = {Campell, Thomas P. and Davidson, Clifford} }Corbin, Solange, „Le manuscrit 201 d’Orléans. Drames liturgiques dits de Fleury“ in: Romania 74, 1953, S. 1–43.
@article{Corbin.1953, author = {Corbin, Solange}, year = {1953}, title = {Le manuscrit 201 d'Orl{\'e}ans. Drames liturgiques dits de Fleury}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {1--43}, volume = {74}, journal = {Romania} }Dolan, Diane Marie, „The notation of Orléans Bibliothèque municipale Ms. 201“ in: Joachim F. Angerer und Josef Lenzenweger (Hrsg.), Consuetudines Monasticae. Eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlaß seines 65. Geburtstages (Studia Anselmiana), Rom 1982, S. 279–288.
@incollection{Dolan.1982, author = {Dolan, Diane Marie}, title = {The notation of Orl{\'e}ans Biblioth{\`e}que municipale Ms. 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {279--288}, series = {Studia Anselmiana}, editor = {Angerer, Joachim F. and Lenzenweger, Josef}, booktitle = {Consuetudines Monasticae. Eine Festgabe f{\"u}r Kassius Hallinger aus Anla{\ss} seines 65. Geburtstages}, year = {1982}, address = {Rom} }Boor, Joachim de, Die Textgeschichte der lateinischen Osterfeiern, Tübingen 1967.
@book{DTdlOBoor, author = {de Boor, Joachim}, year = {1967}, title = {Die Textgeschichte der lateinischen Osterfeiern}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {T{\"u}bingen} }Bryan, George B., Ethelwood and medieval music-drama at Winchester. The Easter play, its author, and its milieu, Bern 1981.
@book{EammdaWTEpiaaimBryan, author = {Bryan, George B.}, year = {1981}, title = {Ethelwood and medieval music-drama at Winchester. The Easter play, its author, and its milieu}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Bern} }Arlt, Wulf, Ein Festoffizium des Mittelalters aus Beauvais in seiner liturgischen und musikalischen Bedeutung, Köln 1970.
@book{EFdMaBislumBArlt, author = {Arlt, Wulf}, year = {1970}, title = {Ein Festoffizium des Mittelalters aus Beauvais in seiner liturgischen und musikalischen Bedeutung}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {K{\"o}ln} }Elders, Willem, „Gregorianisches in liturgischen Dramen der Hs. Orléans 201“ in: Acta Musicologica 36, 1964, S. 169–177.
@article{Elders.1964, author = {Elders, Willem}, year = {1964}, title = {Gregorianisches in liturgischen Dramen der Hs. Orl{\'e}ans 201}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {169--177}, volume = {36}, journal = {Acta Musicologica} }Geering, Arnold, „Die Nibelungenmelodie in der Trierer Marienklage“ in: Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, Kongressbericht Basel 1949 , S. 118–121.
@incollection{Geering., author = {Geering, Arnold}, title = {Die Nibelungenmelodie in der Trierer Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {118--121}, booktitle = {Internationale Gesellschaft f{\"u}r Musikwissenschaft, Kongressbericht Basel 1949} }Klöckner, Stefan, „Elevatio crucis und Visitatio sepulchri. Das spätmittelalterliche Essener Osterspiel und eine Realisierung 2005“ in: BzG 39, 2005, S. 67–82.
@article{Klockner.2005, author = {Kl{\"o}ckner, Stefan}, year = {2005}, title = {Elevatio crucis und Visitatio sepulchri. Das sp{\"a}tmittelalterliche Essener Osterspiel und eine Realisierung 2005}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {67--82}, volume = {39}, journal = {BzG} }Morent, Stefan, „Die Weingartner Visitatio sepulchri aus dem 13. Jahrhundert und ihre Realisierung in der Basilika Weingarten 2010“ in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Zentralkommitee der Deutschen Katholiken (Hrsg.), Inszenieren – Inspirieren – Konfrontieren. Potentiale zwischen Kirche und Theater. Dokumentation eines Werkstattgesprächs der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken (ZdK), 12. September 2010 (Arbeitshilfen), Bonn 2001, S. 179–194.
@incollection{Morent.2001, author = {Morent, Stefan}, title = {Die Weingartner Visitatio sepulchri aus dem 13. Jahrhundert und ihre Realisierung in der Basilika Weingarten 2010}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {179--194}, series = {Arbeitshilfen}, editor = {{Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Zentralkommitee der Deutschen Katholiken}}, booktitle = {Inszenieren -- Inspirieren -- Konfrontieren. Potentiale zwischen Kirche und Theater. Dokumentation eines Werkstattgespr{\"a}chs der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken (ZdK), 12. September 2010}, year = {2001}, address = {Bonn} }Omlin, Ephrem, „Das ältere Engelberger Osterspiel und der Cod. 103 der Stiftsbibliothek Engelberg“ in: Alfred A. Schmidt (Hrsg.), Corolla Heremitana. Neue Beiträge zur Kunst und Geschichte Einsiedelns und der Innerschweiz , Olten 1964, S. 101–126.
@incollection{Omlin.1964, author = {Omlin, Ephrem}, title = {Das {\"a}ltere Engelberger Osterspiel und der Cod. 103 der Stiftsbibliothek Engelberg}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {101--126}, editor = {Schmidt, Alfred A.}, booktitle = {Corolla Heremitana. Neue Beitr{\"a}ge zur Kunst und Geschichte Einsiedelns und der Innerschweiz}, year = {1964}, address = {Olten} }Osthoff, Helmuth, „Deutsche Liedweisen und Wechselgesänge im mittelalterlichen Drama“ in: Archiv für Musikforschung 7, 1942, S. 65–81.
@article{Osthoff.1942, author = {Osthoff, Helmuth}, year = {1942}, title = {Deutsche Liedweisen und Wechselges{\"a}nge im mittelalterlichen Drama}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {65--81}, volume = {7}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikforschung} }Stäblein, Bruno, „Zur Musik des Ludus de Antichristo“ in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph Müller-Blattau , Kassel 1966, S. 312–327.
@incollection{Stablein.1966, author = {St{\"a}blein, Bruno}, title = {Zur Musik des Ludus de Antichristo}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {312--327}, booktitle = {Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph M{\"u}ller-Blattau}, year = {1966}, address = {Kassel} }Young, Karl, The drama of the medieval church, Oxford 1933.
@book{TdotmcYoung, author = {Young, Karl}, year = {1933}, title = {The drama of the medieval church}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Oxford} }Smoldon William L. und Cynthia Bourgeault, The Music of the Medieval Church Dramas, London and New York 1980.
@book{TMotMCDSmoldonWilliamL.&Bourgeault, author = {{Smoldon William L.} and Bourgeault, Cynthia}, year = {1980}, title = {The Music of the Medieval Church Dramas}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {London and New York} }Traub, Andreas, „Zu einigen Melodien der Wolfenbütteler Marienklage“ in: Josef Kuckertz (Hrsg.), Neue Musik und Tradition. Festschrift Rudolf Stephan zum 65. Geburtstag , Laaber 1990, S. 55–71.
@incollection{Traub.1990, author = {Traub, Andreas}, title = {Zu einigen Melodien der Wolfenb{\"u}tteler Marienklage}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {55--71}, editor = {Kuckertz, Josef}, booktitle = {Neue Musik und Tradition. Festschrift Rudolf Stephan zum 65. Geburtstag}, year = {1990}, address = {Laaber} }———, „Zeitdimensionen im Geistlichen Spiel. Zur Marienklage mit Propheten im Debs-Codex“ in: Kurt Drexel (Hrsg.), Musikgeschichte Tirols. Von den Anfängen bis zur Frühen Neuzeit, Bd. 1 (Schlern-Schriften), Innsbruck 2001, S. 335–351.
@incollection{Traub.2001, author = {Traub, Andreas}, title = {Zeitdimensionen im Geistlichen Spiel. Zur Marienklage mit Propheten im Debs-Codex}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {335--351}, series = {Schlern-Schriften}, editor = {Drexel, Kurt}, booktitle = {Musikgeschichte Tirols. Von den Anf{\"a}ngen bis zur Fr{\"u}hen Neuzeit, Bd. 1}, year = {2001}, address = {Innsbruck} }Boletta, William Louis, The role of music in medieval German Drama. Easter Plays and Passion Plays, Vanderbilt 1967.
@book{TromimGDEPaPPBoletta, author = {Boletta, William Louis}, year = {1967}, title = {The role of music in medieval German Drama. Easter Plays and Passion Plays}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {Vanderbilt} }Ursprung, Otto, „Das Sponsus-Spiel“ in: Archiv für Musikforschung 3, 1938, S. 80–95.
@article{Ursprung.1938, author = {Ursprung, Otto}, year = {1938}, title = {Das Sponsus-Spiel}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, pages = {80--95}, volume = {3}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikforschung} }Ziegeler, Hans-Joachim (Hrsg.), Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters und der Frühen Neuzeit [Tagung vom 25. bis 27.03.1999 an der Universität zu Köln], Tübingen 2004.
@book{Ziegeler.2004, year = {2004}, title = {Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltliches Drama des Mittelalters und der Fr{\"u}hen Neuzeit [Tagung vom 25. bis 27.03.1999 an der Universit{\"a}t zu K{\"o}ln]}, keywords = {DramatisierungDerLiturgie;Literatur}, address = {T{\"u}bingen}, editor = {Ziegeler, Hans-Joachim} }
Offizien (Historiae)
Je nach Überlieferung konnten auch nur Teile der für ein komplettes Offzium notwendigen Gesänge vorliegen, z.B. wenn ein für den säkularen Cursus verfasstes Offizium für den monastischen Cursus adaptiert werden sollte. In diesem Fall wurden die fehlenden Gesänge meist durch Gesänge aus dem Bestand des Commune aufgefüllt.
Berthold berichtet, sein Lehrer Hermann der Lahme habe u.a. Gesänge zu Verehrung der Heiligen Afra, Wolfgang und Magnus von »außerordentlicher Süße und überragendem Wohlklang« in Wort und Musik gesetzt. Auch andere zeitgenössische Quellen preisen die herausragende Meisterschaft und »Süße« seiner Kompositionen. Inzwischen konnten diese zu einem großen Teil von der jüngeren Forschung, vor allem durch die Arbeiten David Hileys , wiederentdeckt werden. Umstritten ist, ob Hermannus in einer zwischen 1240 und 1250 in der Abtei St. Alban in London angefertigten Handschrift rechts neben Euklid sitzend mit dem Astrolabium in der Hand dargestellt ist (GB-Ob, Ashmole 304 <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/5885f370-ffea-4c09-9d01-a0d4399e82af/>, f. 2v).
In seinen Offizien gestaltet Hermann die Melodien nach der neuen Auffassung der Modi, wie er sie selbst in seinem Traktat Musica darlegt: Als Strukturtöne der Modi gelten jetzt Finalis, Unterquart, Oberquint und Oktav, die für alle Modi ein Raster bilden, um das herum sich die anderen Töne ranken. In Hermanns Kompositionen wird diese Neustrukturierung besonders ohrenfällig, da fast jedes einzelne Wort, jeder größere Abschnitt von diesen deutlich vernehmbaren Gerüsttönen geprägt wird. Hermann gliedert hierzu die antike Doppeloktav A–a’, wie bereits Hucbald, in vier Tetrachorde mit der von den Finales der Modi her bekannten gleich bleibenden Intervallstruktur Ganzton (tonus) – Halbton (semitonus) – Ganzton (tonus). Hierbei sind das erste (grave) und das zweite (finale), sowie das dritte (superior) und das vierte Tetrachord (excellens) miteinander verbunden, während das zweite und das dritte durch einen Ganzton getrennt sind und die Tonstufe a’ als zusätzlicher höchster Ton erscheint. Hermannus kennt auch die Tonstufe Gamma, bezieht sie aber nicht in seine tonsystematischen Überlegungen mit ein. Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass die einzelnen Tonstufen innerhalb der Tetrachorde strukturell immer gleich sind, d.h. sie besitzen durch allle Tetrachorde hindurch dieselbe intervallische Umgebung. So definiert Hermann vier in ihrem Intervallaufbau verschiedene Quartgattungen, die bei A beginnend jeweils von den graves zu den Tonstufen mit entsprechender Position in den finales reichen. Dass dabei die vierte Quartgattung D–G mit der ersten A–D strukturell identisch ist und trotzdem gesondert gezählt wird, erscheint zunächst als Inkonsistenz, klärt sich aber beim Aufbau der modalen Oktaven. Wirklich vier verschiedene Quintgattungen bildet Hermannus dann jeweils zwischen den finales und den superiores. Die Tonstufen D und d nehmen dabei einen besonderen Platz ein, denn sie bilden gleichzeitig die letzte Position der graves (IV) und die erste der finales (I) bzw. die letzte der superiores und die erste der excellentes:
Quart- und Quintgattungen nach Hermannus Contractus:
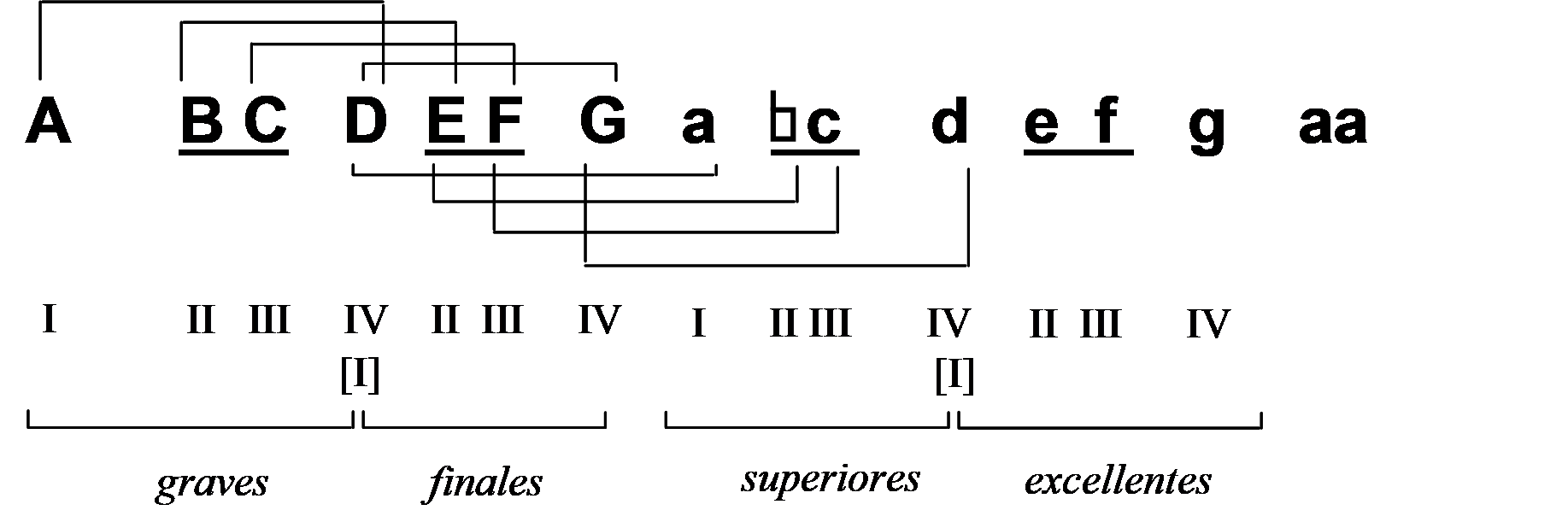
| Quarten | Quinten |
|---|---|
| 1. A BC D (t s t) | 1. D EF G a (t s t t) |
| 2. BC D E (s t t) | 2. EF G a (s t t t) |
| 3. C D EF (t t s) | 3. F G a c (t t t s) |
| 4.=1. D EF G (t s t) | 4. G a c d (t t s t) |
Anm.: Mit B und (= b quadratum) bezeichnet Hermann die modernen Tonstufen H und h.
Die Modi werden nun jeweils aus einer Kombination von Quart- und Quintgattungen gleicher Ordnung gebildet, die plagalen aus Quart+Quint, die authentischen aus Quint+Quart. Damit ergibt sich eine Strukturierung der Modi durch die Rahmentöne der sie konstituierenden Intervalle, also durch Quarten und Quinten. Hermann betont dabei nicht ohne Stolz als Vorteil seines Systems, dass diese modalen Strukturtöne jeweils von den ersten, zweiten, dritten und vierten Tonstufen der graves, finales und superiores bzw. der finales, superiores und excellentes gebildet werden und so besonders elegant darstellbar und leicht auffindbar sind. Die Oktav D–d erscheint dabei zweimal, allerdings in verschiedener interner Gliederung: einmal als plagaler G-Modus mit G als Finalis, das andere Mal als authentischer D-Modus mit D als Finalis, was die oben angesprochene vierte Quartengattung D–G erklärt:
Strukturtöne der Modi:
Hypodorisch (Protus plagalis):
A D a
Hypophrygisch (Deuterus plagalis):
B E
Hypolydisch (Tritus plagalis):
C F c
Hypomixolydisch (Tetrardus plagalis):
D G d
Dorisch (Protus autenticus):
D a d
Phrygisch (Deuterus autenticus):
E e
Lydisch (Tritus autenticus):
F c f
Mixolydisch (Tetrardus autenticus):
G d g
Bsp.: Deutlicher als in der Repetenda des 7. Responsoriums (Cum vitam mores et erudicio der Matutin aus Hermanns Wolfgangs-Offizium konnte beispielsweise die neue Auffassung der Modi kaum klingend verdeutlicht werden: Finalis, Quint und Oktav sind die unüberhörbaren Ankerpunkte der Melodik, und die einzelnen Worte, aber auch das Schlussmelisma, sind fast ausnahmslos in den unteren Quintrahmen und den darüber liegenden Quartrahmen des 7. Modus gefasst, sei es in direkten Sprüngen oder mit ausgefüllten Skalenläufen (s. Rahmen-Markierungen):
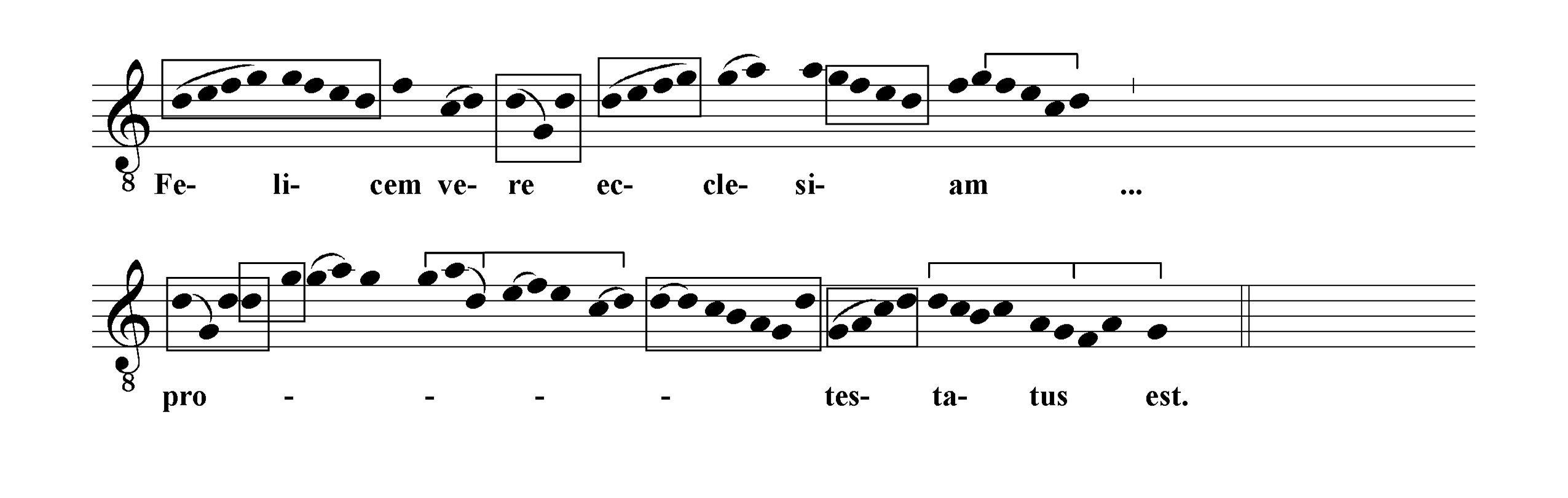 Hermannus Contractus: Repetenda des Responsoriums Cum vitam mores aus
dem Wolfgangs-Offizium (Transkription Stefan Morent).
Hermannus Contractus: Repetenda des Responsoriums Cum vitam mores aus
dem Wolfgangs-Offizium (Transkription Stefan Morent).
Regelmäßig findet in Hermanns Kompositionen ein Zusammenschluss von plagalem und authentischem Ambitus statt, den Johannes (Affligemensis) um 1100 als Ohrenkitzel (pruritum aurium) einiger »Neutöner« (novi modulatores) streng ablehnt, von Marchetto da Padova aber im 14. Jahrhundert in seinem Traktat Lucidarium in arte musicae planae als modus mixtus (1317–1318) bezeichnen wird. Nach Hermanns Vorstellung sind diese Gerüsttöne als Grundlage der musica an sich auch ein Abbild der himmlischen Harmonie. In vielem weisen seine Kompositionen damit auf andere des 11. und 12. Jahrhunderts voraus, wie z.B. auf die Gesänge von Hildegard von Bingen. Weiter sind in Hermanns Kompositionen eine Ausdehnung des Gesamttonumfangs, die besonders große zeitliche Ausdehnung von einigen Antiphonen und Responsorien und die Verwendung langer Melismen zu beobachten. Hermanns Gesänge erreichen immerhin mehrfach den Maximalumfang von Oktave+Sext, während beispielsweise die Papst Leo IX. zugeschriebenen Offizien maximal den Umfang Oktav+Quint aufweisen. Das traditionelle Choralrepertoire kennt einen solchen Umfang nur an ganz wenigen herausragenden Stellen, wie beim Vers Pascha nostrum des Oster-Alleluias, ansonsten gilt bereits die Dezim als Sonderfall, wie Johannes betont (nonam vel decimam rarissime contingant). Bei Hermann stellt der traditionelle Oktav- bzw. Non-Ambitus schon die Ausnahme dar und das Bestreben, den Tonraum bis an seine Grenzen zu strecken, zeigt sich in der mehrfachen Verwendung des tiefen Gamma, einer Tonstufe, die eigentlich außerhalb seiner theoretischen Konzeption liegt und besonders plakativ beim Erscheinen eines schrecklichen Dämons (demon nigerrimus et horrore plenus apparuit) in der Afra-Historia eingesetzt wird. Hermanns Responsorien, vor allem aber seine Magnificat-Antiphonen, weisen eine Länge auf, die ihresgleichen sucht, und er verwendet ausladende Melismen mit bis zu 53 Tönen, so z.B. beim letzten Responsorium Martyr sancta dei der zweiten Nokturn des Afra-Offiziums.
Ob das überlieferte Gesangscorpus von Hildegard von Bingen bereits von der ursprünglichen Konzeption her als Sammelwerk, so wie es in den Handschriften entgegentritt, gedacht war, und ob dieses Sammelwerk von Hildegard selbst unter dem heute benutzten Titel erstellt wurde, wird von der neueren Forschung mit guten Gründen bezweifelt.
Dass die beiden Haupthandschriften zur musikalischen Überlieferung bei Hildegard, der Codex Dendermonde (B-DEa [Dendermonde, Bibliothek der Abtei S. Pieters & Paulus] Cod. 9, um 1175, D) und der sogenannte Wiesbadener »Riesencodex« (D-WIl [Wiesbaden, Hessische Landesbibliothek] Hs. 2, 1177–1179/1180–1187?, R), im Rupertsberger Skriptorium entstanden sind, wurde dagegen bereits in den 1950er Jahren schlüssig wissenschaftlich nachgewiesen. Die Notation in diesen Quellen stammt aus dem 12. Jahrhundert und deren Schreiber aus ein- und demselben Skriptorium, das auf dem Rupertsberg anzusiedeln ist. Hierfür spricht auch der Befund der jüngeren Hildegardforschung, dass die Formung der Figur Hildegard als Seherin mit prophetischem Anspruch offenbar ihr Epizentrum im unmittelbaren Umkreis des Rupertsberges hatte und die Filiation ihrer Schriften von dort über relative wenige eng befreundete Klöster, etwa Trier oder Zwiefalten, erfolgte – was durchaus im Widerspruch steht, zu dem bereits von Hildegard und ihrem Umkreis gestalteten Image weitläufiger Bekanntheit, wie es etwa in den Redaktionen des Briefcorpus zu greifen ist. Zumindest bei der größeren der beiden Hauptmusikhandschriften, dem »Riesenkodex«, handelt es sich um ein über einen längeren Zeitraum durchgeführtes Unternehmen, das offenbar den Zweck hatte, Hildegards Werk, und zwar den visionären Teil, in einer Gesamtschau zusammen zu stellen. Die einzelnen Teile dieser »Gesamtausgabe« stammen aus verschiedenen zeitlichen Abschnitten, die von den Lebzeiten Hildegards und unter ihrer Aufsicht bis in die 80er Jahre nach dem Tode Hildegards als Redaktion ihrer engsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reichen. Der musikalische Teil muss nach Ausweis der Lagenmarkierung und auf Grund von Gebrauchsspuren aus einer anderen Handschrift stammen oder getrennt entstanden und später dem Codex beigebunden worden sein. Trotzdem repräsentiert der Riesencodex offenbar die Art und Weise, wie die klösterliche Memoria des Rupertsbergs Hildegard verstanden wissen wollte. In den Kanonisationsakten des kurz nach Hildegards Tod in die Wege geleiteten und erst vor kurzem zum Abschluss gekommenen Heiligsprechungsverfahrens wird ihre musikalische Produktion (cantus eius) als offenbar wichtige Komponente dieses Gesamtbildes extra erwähnt. Die Sammlung der Lieder und des Dramas von Hildegard ist schon deshalb äußerst bemerkenswert für die Überlieferungstradition im Mittelalter, weil sie von einer Frau verfasst wurden, die namentlich bekannt ist. Das gesamte riesenhafte Repertoire des Gregorianischen Chorals für Stundengebet und Messe ist ja fast ausnahmslos anonym überliefert und wenn in diesem Zusammenhang Personen benannt werden, sind es Männer.
Fragt man kritisch nach dem Anteil Hildegards an ihrer Musik, so kann man aufgrund der überlieferten Zeugnisse folgende Hypothese aufstellen: Hildegard vernahm in der Schau Texte und Melodien, die sie vermutlich zunächst singend wiedergab. Dem folgten erste Versuche, die Erscheinungen schriftlich zu fixieren. Wieder später wurde mit ihrem Wissen eine schriftliche Fassung der Gesänge in zyklisch geordneter Reihenfolge erstellt. Diese wurde vermutlich erstmals zwischen 1163 und 1175 für den Codex Dendermonde festgehalten, der dann als Geschenk an das Zisterzienserkloster Villers ging. Eine zweite Redaktion integrierte neu entstandene Gesänge und vervollständigte so die Sammlung für die Präsentation des Gesamtwerks, wie sie heute im Riesenkodex vorliegt. Für diesen Prozess von der ursprünglichen visio bis zur Niederschrift in den heute erhaltenen Handschriften sind verschiedene Stufen des Bearbeitens und Redigierens durch »helfende Hände« anzunehmen. Wir wissen nicht genau, wer die Schreiber waren, woher sie kamen oder aus welcher Tradition sie stammten. Waren es Nonnen des Rupertsberger Konvents oder Mönche befreundeter Klöster wie Trier oder Zwiefalten, die sich vielleicht längere Zeit auf dem Rupertsberg aufhielten und wie bei der Abfassung der Visionsschriften, so auch bei der Erstellung der Musikhandschriften mitarbeiteten? Die Beantwortung dieser Fragen, soweit möglich, ist umso wichtiger, als die Schreiber oder Schreiberinnen eben für die Codierung der Musik Hildegards in musikalische Zeichen verantwortlich waren und damit die Kompositionen in der Form fixierten, die für uns heute die einzige Zugangsmöglichkeit darstellt. Sie schrieben nicht ohne Voraussetzungen, sondern standen in einem bestimmten Traditionszusammenhang.
Generell lässt sich sagen, dass die Hildegardhandschriften dem Typus der sogenannten »deutschen« Neumenschrift (auf Linien) zuzuordnen sind. Dieser Typus umfasst jedoch zahlreiche regional, chronologisch und institutionell verschiedenartige Untertypen, die bisher noch nicht im Detail erforscht sind. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich die Zeichen der adiastematischen Neumenschriften bei der Übertragung auf Linien verändern bzw. in der Begegnung mit anderen Schreibschulen neue Zeichen aufnehmen konnten, so dass sogenannte »Kontaktneumensysteme« entstanden. So deuten viele Zeichen der Hildegardhandschriften auf den rheinisch-niederländischen Raum, manche aber wiederum lassen an Einflüsse der Metzer bzw. lothringischen Notation denken oder finden sich in Zisterziensernotationen wieder. Bestand und Anordnung der Gesänge in den beiden Handschriften sind verschieden, die textlich-musikalische Überlieferung ist aber bis auf kleinere Varianten sehr stabil. Größte Unterschiede zeigen sich bei der Ausgestaltung der »Gattungsmomente«. Diese Unsicherheiten sind wohl auf den längeren Redaktionsprozess zurückzuführen, den die Gesänge auf ihrem Weg von der unmittelbaren Auditionserfahrung Hildegards bis zur schriftlichen Fixierung durchliefen.
So ist z.B. das Responsorium O viriditas in Handschrift R (f. 470va–b) mit einer Doxologie, in Handschrift D (f. 162r–162v) jedoch ohne eine solche notiert. Und der Gesang O vos felices radices ist in R (f. 469ra–b) als Responsorium, aber ohne Repetenda, in D (f. 160r–v) dagegen als »Antiphona«, aber mit Repetenda eingetragen. Die Antiphon O beatissime Ruperte erscheint in R (f. 471ra, Edition Lieder S. 89–90) mit, in D (f. 164v) ohne Alleluia-Ruf. Auch die Differentiae könnten in den Handschriften nachgetragen sein, und es ist nicht immer klar, auf welchen Gesang sie sich beziehen. Zwei Gesänge sind gar mit der sonst nicht belegten Gattungsbezeichnung Symphonia/Simphonia (Symphonia virginum : D, f. 164v/R, f. 478r; Symphonia viduarum : D, f. 166r–v/R, f. 478v) rubriziert, was wohl darauf hindeutet, dass diese in keine der bekannten Gattungen eingeordnet werden konnten und eine besondere Nähe zu dem »Klang des Himmels« beinhalten, den Hildegard nach eigenen Aussagen in ihren Auditionen vernahm. Hildegard überschreitet nicht nur die Normen des älteren Choralrepertoires, sondern auch die Neuerungen von Hermannus Contractus: Während Hermannus beim E-Modus noch nicht die ebenso deutliche Gliederung in die Gerüsttöne anwendet wie bei den anderen Modi, überträgt Hildegard das neue Strukturierungsmodell auf alle Modi und damit auch auf den E-Modus.
Bsp.: So beginnt die Sequenz auf den Hl. Eucharius O Euchari (R, f. 476ra–b) ganz demonstrativ mit der Eröffnungsformel e–h–e’ und hebt sich damit überaus deutlich von der Musiksprache des älteren Chorals, aber auch von anderen zeitgenössischen Formulierungen des 12. Jahrhunderts ab:
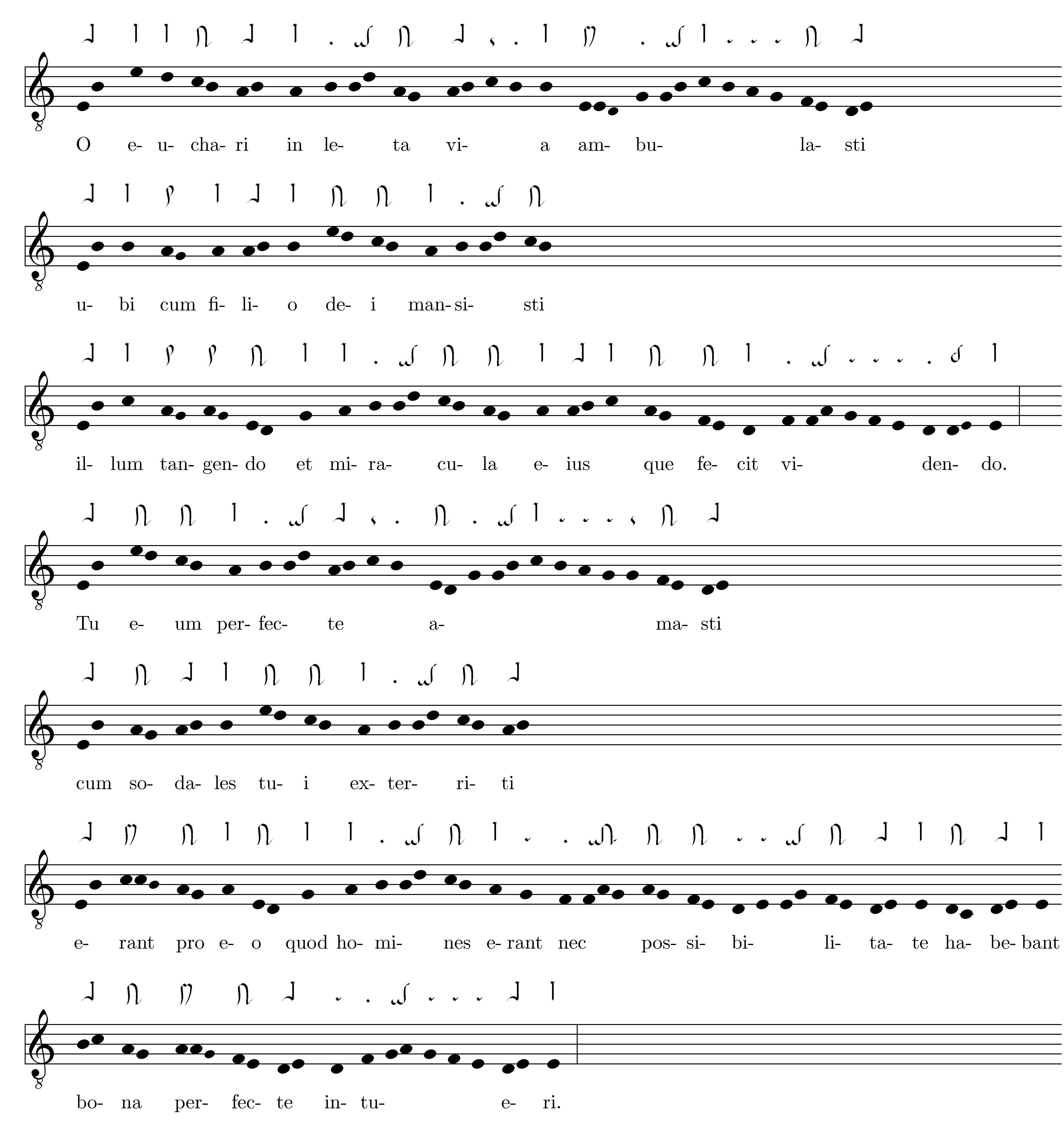 Hildegard von Bingen: Beginn der Sequenz O Euchari (Transkription
Stefan Morent)
Hildegard von Bingen: Beginn der Sequenz O Euchari (Transkription
Stefan Morent)
Während Hermannus in seinen Kompositionen den Maximalumfang von Oktave + Sext erreicht, umfasst Hildegards Responsorium O vos angeli (R, f. 468va–b) den enormen Umfang von zwei Oktaven + Quinte (Γ–d”).
Im Ordo Virtutum stellt Hildegard ein subtiles Geflecht vielfältiger modaler und melodischer Beziehungen zwischen den Reden der einzelnen Virtutes und der Anima her, die eine kontrollierte musikalische Konzeption dieses Dramas belegen. Gleich zu Beginn wird die Rede der Propheten und Patriarchen des Alten Bundes durch die tiefe und damit ferne, Ehrwürdigkeit symbolisierende plagale Region des D-Modus verklanglicht. Dies wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass es sich hier um den Beginn des Responsoriums Qui sunt hi qui ut nubes , V. Dorsa eorum handelt, das sich im Stundengebet an Apostelfesten in der Vesper oder in der Matutin findet. Dies ist bisher die einzige bekannte Stelle, an der Hildegard einen Gesang aus dem Choralrepertoire wörtlich in direktem Zusammenhang mit ihren eigenen Kompositionen zitiert. Dass dies, wie Luca Ricossa vermutet, bedeutet, hier müsse auch das gesamte Responsorium ergänzt werden, ist allerdings durchaus fraglich. Im Riesencodex folgt die Antwort der Virtutes in unmittelbarem Anschluss an das letzte Wort nubes notiert. Hildegard könnte das Zitat auch bewusst herausgeschnitten haben, um die Antwort der Virtutes in ihrer eigenen melodischen Sprache unmittelbar anzuschließen, und damit einen Gesang aus dem Repertoire des älteren Chorals, der den Patriarchen des Alten Bundes zukommt, einem ihrer neuen Gesänge, der die Virtutes charakterisiert, gegenüber zu stellen. Die Virtutes antworten zwar mit der Quint d–a, die die Repetenda des Responsoriums Et quasi mit der Tonfolge d–d–a aufgreift, dann folgt aber bereits bei -mi-ra die für Hildegard typische Folge d–a–d', die bezeichnenderweise im Responsorium nirgends erscheint. Bei der Erwähnung der Patriarchen und Propheten selbst (antiqui sancti) steigt die Melodie aber wieder zur Unterquart ab. Gleichzeitig bilden die beiden unterschiedlichen Regionen des D-Modus, die doch durch die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Finalis miteinander verbunden sind, das Band zwischen den Virtutes und den Heiligen des Alten Bundes und zwischen dem alten Choralrepertoire und Hildegards Neukompositionen ab, die jene als Symbiose zwischen Wurzeln und Zweigen (nos sumus radices et vos rami) beschreiben und dabei bereits den D-Modus verlassen und den E-Modus des Ordo Virtutum einleiten:

Patriarche et prophete: Qui sunt hi, Virtutes: Beginn von O antiqui sancti, Patriarche et prophete: Nos sumus radices (R, f. 478vb, Transkription: Stefan Morent).
Quellen
Hermannus Contractus: Afra-Offizium aus Prüfening: D-Mbs Clm 23037, f. 239v-241v, 12. Jahrhundert
Antiphon Alma redemptoris mater: D-Mbs Clm 23037, f. 241v
Antiphonar aus der Zeit um 1200: Disibodenberg, Sponheim(?): CH-EN (Stiftsbibliothek Kloster Engelberg) 103
B-DEa [Dendermonde, Bibliothek der Abtei S. Pieters & Paulus] Cod. 9
D-WIl Hs. 2 <https://hlbrm.digitale-sammlungen.hebis.de/handschriften-hlbrm/content/pageview/449620>
Edition
Tractus Commovisti Domine: GT 90
Quellentexte
Hiley, David und Walter Berschin, Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sancti Magni (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2013.
@book{HC11HSMHiley&Berschin, author = {Hiley, David and Berschin, Walter}, year = {2013}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sancti Magni}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/22}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen} }——— (Hrsg.), Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sancti Wolfgangi Episcopi Ratisbonensis (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2002.
@book{Hiley.2002, year = {2002}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sancti Wolfgangi Episcopi Ratisbonensis}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/7}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen}, editor = {Hiley, David and Berschin, Walter} }——— (Hrsg.), Hermannus Contractus (1013–1054): Historia Sanctae Afrae martyris Augustensis (Wissenschaftliche Abhandlungen), Ottawa 2004.
@book{Hiley.2004b, year = {2004}, title = {Hermannus Contractus (1013--1054): Historia Sanctae Afrae martyris Augustensis}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ottawa}, volume = {65/10}, series = {Wissenschaftliche Abhandlungen}, editor = {Hiley, David and Berschin, Walter} }Newman, Barbara (Hrsg.), Saint Hildegard of Bingen: Symphonia. A critical edition of the ’Symphonia armonie celestium revelationum’, Ithaca 1988.
@book{Newman.1988, year = {1988}, title = {Saint Hildegard of Bingen: Symphonia. A critical edition of the 'Symphonia armonie celestium revelationum'}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Ithaca}, editor = {Newman, Barbara} }Newman, Barbara und Peter Dronke (Hrsg.), Hildegardis Bingensis opera minora, Turnhout 2007.
@book{Newman.2007, year = {2007}, title = {Hildegardis Bingensis opera minora}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, address = {Turnhout}, editor = {Newman, Barbara and Dronke, Peter} }Stein, Franz A., „Das ältere Offizium des hl. Wolfgang in der Handschrift Clm 14872 aus St. Emmeram zu Regensburg in der Bayerischen Staatsbibliothek München“ in: Franz A. Stein (Hrsg.), Sacerdos et Cantus Gregoriani Magister. Festschrift Ferdinand Haberl zum 70. Geburtstag , Regensburg 1977, S. 279–302.
@incollection{Stein.1977, author = {Stein, Franz A.}, title = {Das {\"a}ltere Offizium des hl. Wolfgang in der Handschrift Clm 14872 aus St. Emmeram zu Regensburg in der Bayerischen Staatsbibliothek M{\"u}nchen}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, pages = {279--302}, editor = {Stein, Franz A.}, booktitle = {Sacerdos et Cantus Gregoriani Magister. Festschrift Ferdinand Haberl zum 70. Geburtstag}, year = {1977}, address = {Regensburg} }Willimann, Joseph, „Hildegard cantrix. Überlegungen zur musikalischen Kunst Hildegards von Bingen (1098–1179)“ in: Antonio Balsassarre (Hrsg.), Musik denken. Ernst Lichtenhahn zur Emeritierung. 16 Beiträge seiner Schülerinnen und Schüler (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Société suisse de musicologie), Bern and New York 2000, S. 9–34.
@incollection{Willimann.2000, author = {Willimann, Joseph}, title = {Hildegard cantrix. {\"U}berlegungen zur musikalischen Kunst Hildegards von Bingen (1098--1179)}, keywords = {Offizien;Quellentexte}, pages = {9--34}, series = {Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Publications de la Soci{\'e}t{\'e} suisse de musicologie}, editor = {Balsassarre, Antonio}, booktitle = {Musik denken. Ernst Lichtenhahn zur Emeritierung. 16 Beitr{\"a}ge seiner Sch{\"u}lerinnen und Sch{\"u}ler}, year = {2000}, address = {Bern and New York} }
Handschriften
B-DEa Cod. 9 <http://www.idemdatabase.org/items/show/160/>
@book{BDC9, title = {B-DEa Cod. 9}, url = {http://www.idemdatabase.org/items/show/160/}, keywords = {Handschriften;Offizien} }CH-EN 103.
@book{CE1b, title = {CH-EN 103}, keywords = {Handschriften;Offizien} }D-KA Aug. LX <http://www.stgallplan.org/stgallmss/viewItem.do?ark=p21198-zz00289pwj>
@book{DKAL, title = {D-KA Aug. LX}, url = {http://www.stgallplan.org/stgallmss/viewItem.do?ark=p21198-zz00289pwj}, keywords = {Handschriften;Offizien} }D-Mbs Clm 23037.
@book{DMC2b, title = {D-Mbs Clm 23037}, keywords = {Handschriften;Offizien} }
Literatur
Kienzle, Beverly Mayne, A companion to Hildegard of Bingen (Brill’s companions to the Christian tradition), Boston 2013.
@book{ActHoBKienzle, author = {Kienzle, Beverly Mayne}, year = {2013}, title = {A companion to Hildegard of Bingen}, keywords = {Literatur;Offizien}, address = {Boston}, volume = {45}, series = {Brill's companions to the Christian tradition} }Berschin, Walter und David Hiley, Die Offizien des Mittelalters. Dichtung und Musik (Regensburger Studien zur Musikgeschichte), Tutzing 1999.
@book{DOdMDuMBerschin&Hiley, author = {Berschin, Walter and Hiley, David}, year = {1999}, title = {Die Offizien des Mittelalters. Dichtung und Musik}, keywords = {Literatur;Offizien}, address = {Tutzing}, volume = {1}, series = {Regensburger Studien zur Musikgeschichte} }Hiley, David, „Die Afra-Gesänge des Hermannus Contractus. Liturgische Melodien und die Harmonie des Universums“ in: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 38, 2004, S. 112–119.
@article{Hiley.2004, author = {Hiley, David}, year = {2004}, title = {Die Afra-Ges{\"a}nge des Hermannus Contractus. Liturgische Melodien und die Harmonie des Universums}, keywords = {Literatur;Offizien}, pages = {112--119}, volume = {38}, journal = {Jahrbuch des Vereins f{\"u}r Augsburger Bistumsgeschichte} }Hughes, Andrew, Late Medieval liturgical offices (Subsidia Mediaevalis), 1994-1996.
@book{LMloHughes, author = {Hughes, Andrew}, year = {1994-1996}, title = {Late Medieval liturgical offices}, keywords = {Literatur;Offizien}, volume = {23-24}, series = {Subsidia Mediaevalis} }Morent, Stefan, „Zur musikalischen Elisabeth-Verehrung im Mittelalter“ in: Christa Bertelsmeier-Kierst (Hrsg.), Elisabeth von Thüringen und die neue Frömmigkeit in Europa (Kulturgeschichtliche Beiträge zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit), Marburg 2008, S. 105–132.
@incollection{Morent.2008, author = {Morent, Stefan}, title = {Zur musikalischen Elisabeth-Verehrung im Mittelalter}, keywords = {Literatur;Offizien}, pages = {105--132}, series = {Kulturgeschichtliche Beitr{\"a}ge zum Mittelalter und zur fr{\"u}hen Neuzeit}, editor = {Bertelsmeier-Kierst, Christa}, booktitle = {Elisabeth von Th{\"u}ringen und die neue Fr{\"o}mmigkeit in Europa}, year = {2008}, address = {Marburg} }
Lateinische Cantiones
Die Handschrift D-Sl HB I 95 aus dem späten 12. Jahrhundert befand sich im 15. Jahrhundert in der Bibliothek des Klosters Weingarten, ihre Provenienz ist letztlich jedoch ungeklärt. Im Gegensatz zum weltlichen Repertoire der sogenannten »Weingartner Liederhandschrift« (D-Sl HB XIII, 1) handelt es sich hier um eine Sammlung geistlich-gelehrter Unterhaltung wie sie im klösterlichen Umfeld gepflegt wurde. Mit ihren Conductus, Sequenzen, Tropen und Liedern ist sie der Carmina burana-Handschrift (D-Mbs clm 4660/4660a) vergleichbar, und tatsächlich finden sich einige Stücke aus den Carmina burana auch in dieser »Weingartner« Handschrift. Außerdem enthält sie einige der berühmten Kompositionen, die im Umfeld der Kathedrale von Notre Dame in Paris um 1200 entstanden und offenbar ihren Weg bis nach Süddeutschland fanden.
Der Conductus Samson dux fortissime (f. 30r-31v illustriert die biblische Geschichte von Samson und Dalila in einer Art »Mini-Oper« und gibt damit einen interessanten Einblick in die lateinischsprachige »Unterhaltung« im Milieu der Kleriker und geistlichen Hofhaltungen:
| Samson dux fortissime victor potentissime | Samson, überaus starker Fürst, gewaltiger Sieger, |
| quid facis in carcere o victor omniu[m] | was machst Du im Kerker, Du Unbesiegbarer? |
| quis te quivit vincere vel p[er] so[m]niu[m] | Wer konnte Dich besiegen, während Du schliefst? |
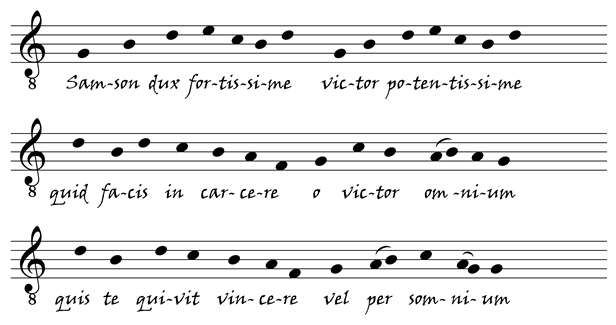
Beginn des Planctus sampsonis: D-Sl HB I 95, f. 30r: In der Handschrift ist die Melodie mit adiastematischen deutschen Neumen notiert, die keine genauen Tonhöhen angeben. In einer englischen Handschrift aus dem 3. Viertel des 13. Jahrhunderts (GB-Lbl Harley 978 <http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_978>, 2r–4v), die auch den berühmten »Sommerkanon« Sumer is icumen in enthält, ist dieser Planctus gegenüber der Weingartner Handschrift mit kleinen Varianten als einzige Überlieferung vollständig auf Linien notiert. Mit ihrer Hilfe kann die Melodie in der Weingartener/Stuttgarter Handschrift rekonstruiert werden (Transkription: Stefan Morent). Eine unvollständige notierte Version enthält das dominikanische Tropar Palermo, Biblioteca Nazionale, MS I.B.16 aus dem späten 13. Jh.
Im Codex Las Huelgas finden sich am Ende der Handschrift die Planctus Rex obiit für die Gründer des Klosters Las Huelgas, König Alfonso VIII. und seine Frau, Quis dabit für König Alfonso VII., O monialis concio für Äbtissin Maria Gundissalvi de Aguero und Plange Castilla misera für König Sancho III.
Quellen
Planctus A solis ortu usque ad occidua: F-Pn lat. 1154, f. 132r–133r (wohl aus St. Martial)
»Cambridger Lieder«: GB-Cu Gg 5.35 <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-GG-00005-00035/1>
Petrus Abelardus: Planctus Dolorum solatium: F-Pn n.a. lat. 3126, f. 88v–90v (Tropar aus Nevers, 12. Jahrhundert)
und GB-Ob Bodl. (Oxford, Bodleian Library) 79, f. 53v–56 (13. Jahrhundert)
Planctus cygni: F-Pn lat. 887, frühes 11. Jahrhundert, f. 117v–118r
Handschriften
F-Pn lat. 1154 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84324798/f1.image.r=latin%201154.langDE>
@book{.g, title = {F-Pn lat. 1154}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84324798/f1.image.r=latin%201154.langDE}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }D-Sl HB I 95 <https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=11239&tx_dlf%5Bpage%5D=1>
@book{DSHI9, title = {D-Sl HB I 95}, url = {https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=11239&tx_dlf%5Bpage%5D=1}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }E-BUlh 9 <https://botiga.bnc.cat/?product=el-codex-musical-de-las-huelgas-musica-a-veus-dels-segles-xiii-xiv-volum-ii-facsimil>
@book{EB9, title = {E-BUlh 9}, url = {https://botiga.bnc.cat/?product=el-codex-musical-de-las-huelgas-musica-a-veus-dels-segles-xiii-xiv-volum-ii-facsimil}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }F-Pn lat. 887.
@book{FPl8, title = {F-Pn lat. 887}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }F-Pn n.a. lat. 312.
@book{FPnal3, title = {F-Pn n.a. lat. 312}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }GB-Cu Gg 5.35 <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-GG-00005-00035/1>
@book{GCG53, title = {GB-Cu Gg 5.35}, url = {https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-GG-00005-00035/1}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }GB-Lbl Harley 978 <http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_978>
@book{GLH9b, title = {GB-Lbl Harley 978}, url = {http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_978}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }GB-Ob Bodl. 79.
@book{GOB7b, title = {GB-Ob Bodl. 79}, keywords = {Handschriften;lateinischeCantiones} }
Editionen
Planctus A solis ortu usque ad occidua: Coussemaker 1852, S. iv–v
Planctus Dolorum solatium: Stevens 1986, S. 121–125
Planctus sampsonis: Stevens 1986, S. 153–154
Planctus cygni: Stevens 1986, S. 111–112
Literatur
Irtenkauf, Wolfgang, „Zum Stuttgarter Cantionarium HB I 95“ in: Codices manuscripti 3, 1977, S. 22–30.
@article{Irtenkauf.1977, author = {Irtenkauf, Wolfgang}, year = {1977}, title = {Zum Stuttgarter Cantionarium HB I 95}, keywords = {lateinischeCantiones;Literatur}, pages = {22--30}, volume = {3}, journal = {Codices manuscripti} }Peterson, Nils Holger, „Les planctus d’Abélard et la tradition des drames liturgiques“ in: Jean Jolivet und Henri Habrias (Hrsg.), Pierre Abélard: Colloque international de Nantes , Rennes 2003, S. 267–276.
@incollection{Peterson.2003, author = {Peterson, Nils Holger}, title = {Les planctus d'Ab{\'e}lard et la tradition des drames liturgiques}, keywords = {lateinischeCantiones;Literatur}, pages = {267--276}, editor = {Jolivet, Jean and Habrias, Henri}, booktitle = {Pierre Ab{\'e}lard: Colloque international de Nantes}, year = {2003}, address = {Rennes} }
Religiöse Gesänge in der Volkssprache
Als wichtigste der drei mit Notation erhaltenen Handschriften zu den Cantigas de Santa Maria gelten die Codices E-E (El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo) B.I.2 (420 Cantigas) und E-E T.I.1 (194 Cantigas). Die Handschrift E-Mn 10069 (Codex Toledo) mit 102 Cantigas und weiteren 26 Cantigas in Anhängen scheint die erste Fassung dieser Sammlung um 1270–1280 zu repräsentieren. Wahrscheinlich bestand die Absicht zunächst darin, 100 Cantigas zu sammeln und dabei jede zehnte als Cantiga de loor (allgemeiner Lobgesang für Maria ohne konkreten Bezug auf ein durch Maria gewirktes Wunder) mit Miniaturen, die Musiker darstellen, auszuzeichnen.
In der Handschrift D-HEu pal. lat. 52 <https://doi.org/10.11588/diglit.305#0070> der Universitätsbibliothek Heidelberg aus dem 9. Jahrhundert sind zu **Otfried von Weissenburgs Liber evangeliorum** auf f. 17v für eine Strophe deutsche Neumen mit Zusatzbuchstaben eingetragen, die den musikalisierten Vortrag dieses Stoffes belegen und gleichzeitig mit zu den ältesten Neumenzeugnissen überhaupt gehören. Vermutlich handelt es sich um ein flexibles Vortragsmodell, auf das Otfrieds Kompilation vorgetragen werden sollte. Da dieses Modell nicht später mit lesbaren Tonhöhen aufgezeichnet wurde, kann die Tonfolge nur in ihrem relativen Verlauf rekonstruiert werden.
Vom althochdeutschen Gallus-Lied , das Ratpert von St. Gallen verfasst hat, ist nur die lateinische Übersetzung von Ekkehart IV. in drei St. Galler Handschriften mit adiastematischen Neumen (CH-SGs 168, 174, 393) erhalten.
Neben den Leisen existieren weitere deutschsprachige Lieder vor allem im Kontext von Wallfahrten und Prozessionen, so z.B. das Jakobuslied Wer das ellendt bawen will oder das Prozessionslied Got der vater won uns bei .
In der Tradition der Sangspruchdichtung bildet sich auch eine geistliche Form heraus, die vor allem in der Jenaer Liederhandschrift (D-Ju [Jena, Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek] EI. f. 101) überliefert ist.
Die bekanntesten Lieder des Mönchs von Salzburg dürften die ihm zugeschriebene deutsche Kontrafaktur Joseph lieber nefe min der lateinischen Weihnachts-Cantio Resonet in laudibus und der als Ain radl von drein stymmen bezeichnete dreistimmige Martinskanon Martein lieber herre (A-Wn 4696 <http://data.onb.ac.at/rec/AL00161811>, f. 170v-171r), aus Kloster Lambach) sein. Die Lieder des Mönchs folgen dabei dem Kirchenjahr, mit einem Schwerpunkt auf dem Weihnachts- und Osterfestkreis sowie auf Marianischen Themen. Offenbar dienten sie in der Tradition der Leisen einem gesteigerten Bedürfnis der besseren Rezeption der lateinischen Liturgie durch die volkssprachliche Übertragung, allerdings nicht im Sinne einer deutschsprachigen Liturgie. Die Rubriken in den Handschriften fungieren dabei als Referenz auf den liturgischen Ort des lateinischen Vorbilds.
Zu den ältesten mit lesbarer Notation überlieferten Gesängen in englischer Sprache gehören drei gesungene visionäre Gebete, u.a. an die Jungfrau Maria und den Hl. Nikolaus, die dem Eremiten St. Godric von Finchale (gest. 1170) zugeschrieben werden und von dem Mönch Reginald von Durham aufgezeichnet wurden. Unsicher ist, ob es sich bei Mirie it is while sumer ilast um ein weltliches oder geistliches Lied handelt. Es findet sich mit Melodie notiert auf einem Vorsatzblatt der Handschrift GB-Ob Rawlison G.22, einem lateinischen Psalter aus dem späten 12. Jahrhundert aus der Abtei Thorney . Das Vorsatzblatt selbst wird auf 1230 datiert. Aus dem 13. Jahrhundert sind Worldes blis und Man mei longe him lives wene überliefert, die die weltliche Vergänglichkeit zum Inhalt haben. Edi be tho hevene quene (GB-Ob Corpus Christi College E. 59, f. 113v–114r, Edition PMFC 14, S. 3) ist als Marienlied zweistimmig in der Technik des englischen gymel/gimel mit Bevorzugung der Terz gestaltet, Jesu Cristes milde moder (GB-Lbm Arundel 248, f. 154v–155r, Edition PMFC 14, S. 1–2) stellt eine volkssprachliche Paraphrase der Sequenz Stabat mater dar.
Quellen
- E-Mn 10069 <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/200519>
- E-E B.j.2 <http://www.pbm.com/ lindahl/cantigas/facsimiles/E>
- Laude: I-CT (Cortona, Biblioteca Communale e dell’Accademia Etrusca) 91
und I-Fn Banco Rari 18. <https://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF00004335151#page/1/mode/2up> - Manessischen Liederhandschrift: D-HEu pal. germ. 848 <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848>
- Darstellung von Heinrich von Meisssen/Frauenlob in der Manessischen Liederhandschrift (f. 399r)
- Mondseer Liederhandschrift: A-Wn Cod. 2856
Oswald von Wolkenstein:
- A-Wn Cod. 2777 <https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_6671236>: Im Hauptteil 1425 fertig gestellt mit 42 Liedern, 108 ergänzte Liedtexte und Melodien bis 1441, mit einem Porträt Oswalds auf der Vorderseite des Innendeckels:
- A-Iu, ohne Signatur, Liederhandschrift B <http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1021836&page=1&viewmode=fullscreen>: Im Hauptteil 1432 fertig gestellt, Nachträge bis 1438, mit insgesamt 118 Liedern mit Melodien, mit Brustbild Oswalds auf dem Vorsetzblatt:
Handschriften
E-E B.I.2 und E-E T.I.1.
@book{.f, title = {E-E B.I.2 und E-E T.I.1.}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }A-Iu, ohne Signatur, Liederhandschrift B <http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1021836&page=1&viewmode=fullscreen>
@book{AIoSLB, title = {A-Iu, ohne Signatur, Liederhandschrift B}, url = {http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1021836&page=1&viewmode=fullscreen}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }A-Wn Cod. 2777 <https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_6671236>
@book{AW2b, title = {A-Wn Cod. 2777}, url = {https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_6671236}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }A-Wn Cod. 2856.
@book{AWC2, title = {A-Wn Cod. 2856}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }CH-SGs 168.
@book{CS1c, title = {CH-SGs 168}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }D-HEu pal. germ. 848 <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848>
@book{DHpg8, title = {D-HEu pal. germ. 848}, url = {http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }D-HEu pal. lat. 52 <https://doi.org/10.11588/diglit.305#0070>
@book{DHpl5, title = {D-HEu pal. lat. 52}, url = {https://doi.org/10.11588/diglit.305#0070}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }D-Ju EI. f. 101 <http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00008190>
@book{DJEf1b, title = {D-Ju EI. f. 101}, url = {http://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00008190}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }D-Mbs Cgm 25 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0002/bsb00026305/images/>
@book{DMC2, title = {D-Mbs Cgm 25}, url = {http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00026305/images/}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }D-Mbs Clm 6260 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0004/bsb00047199/images/index.html>
@book{DMC6, title = {D-Mbs Clm 6260}, url = {http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00047199/images/index.html}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }F-Pn fr. 25532 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90631786>
@book{FPf2b, title = {F-Pn fr. 25532}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90631786}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }GB-Ob Rawlison G.22.
@book{GORG2, title = {GB-Ob Rawlison G.22}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }I-CT 91.
@book{IC9, title = {I-CT 91}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }I-Fn Banco Rari 18. <https://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF00004335151#page/1/mode/2up>
@book{IFBR1, title = {I-Fn Banco Rari 18.}, url = {https://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF00004335151#page/1/mode/2up}, keywords = {Handschriften;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache} }
Faksimilia
Liuzzi, Fernando (Hrsg.), La Lauda e i primordi della melodia italiana, Rom 1935.
@book{Liuzzi.1935, year = {1935}, title = {La Lauda e i primordi della melodia italiana}, keywords = {Faksimilia;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache}, address = {Rom}, editor = {Liuzzi, Fernando} }Rumbold, Ian (Hrsg.), Der Mensuralcodex St. Emmeram. Faksimile der Handschrift Clm 14274 der Bayerischen Staatsbibliothek München, Wiesbaden 2006.
@book{Rumbold.2006, year = {2006}, title = {Der Mensuralcodex St. Emmeram. Faksimile der Handschrift Clm 14274 der Bayerischen Staatsbibliothek M{\"u}nchen}, keywords = {Faksimilia;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache}, address = {Wiesbaden}, editor = {Rumbold, Ian} }
Editionen
- Online Edition Cantigas de Santa Maria
- Venite a laudare: Edition Dürrer 1996, Bd. 2, S. 7–8
Literatur
Dürrer, Martin, Altitalienische Laudenmelodien: das einstimmige Repertoire der Handschriften Cortona und Florenz, Kassel u.a. 1996.
@book{ALdeRdHCuFDurrer, author = {D{\"u}rrer, Martin}, year = {1996}, title = {Altitalienische Laudenmelodien: das einstimmige Repertoire der Handschriften Cortona und Florenz}, keywords = {Literatur;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache}, address = {Kassel u.a.} }Huglo, Michel, „Remarques sur un manuscrit de la Consolatio Philosophiae (Londres, British Library, Harleian 3095)“ in: Scriptorium 45, 1991, S. 288–294.
@article{Huglo.1991, author = {Huglo, Michel}, year = {1991}, title = {Remarques sur un manuscrit de la Consolatio Philosophiae (Londres, British Library, Harleian 3095)}, keywords = {Literatur;ReligioeseGesaengeInDerVolkssprache}, pages = {288--294}, volume = {45}, journal = {Scriptorium} }
Formen mehrstimmiger liturgischer Musik
Organum
Neben der Musica enchiriadis überliefern eine Reihe weiterer Traktate das dort gelehrte Organum mit leichten Modifikationen: So z.B. der »Kölner Organumtraktat« (D-KNd Cod. 52 <https://digital.dombibliothek-koeln.de/hs/content/zoom/274823>, Edition, der »Schlettstadter Traktat« (F-SEL [Schlettstadt, Bibliothèque de la ville] 17, f. 38v-39, eine St. Galler Abschrift des »Kölner Organumtraktats« in einer St. Galler Vitruv-Handschrift, 10. Jh.) oder der »Pariser Organumtraktat« (F-Pn lat. 7202 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432473s/f116.item.r=7202>, f. 54v-56v, 11./12. Jh.).
Spätere Theoretiker verstehen den Sinn der Tonordnung der Musica enchiriadis nicht mehr: Guido von Arezzo (Micrologus , nach 1024, und Hermannus Contractus (Musica ) äußern Kritik an den übermäßigen Oktaven und an dem Umstand, dass die gleichen Zeichen nach jedem fünften und neunten Ton, statt nach jedem achten Ton erscheinen. Guido verwendet ein siebenstufiges, diatonisches Oktavensystem; das von ihm in Kapitel 18 gelehrte Organum (diaphonia) ähnelt vom Klangbild her allerdings ziemlich dem des Quartorganums der Musica enchiriadis, nur entwickelt er eine andere theoretische Begründung: Die im Prinzip schon in der Musica enchiriadis vorgebildeten Sexträume, die über den Grenztönen der vox organalis auf C (c–a), F (f–d') und G (g–e') entstehen, fasst Guido in seiner Hexachordlehre. Die Regelung des Zusammenklangs begründet er durch ein Quinten-Verbot und das Zusammenlaufen der beiden Stimmen am Ende in den Einklang mit seiner Lehre vom occursus (= Zusammenlaufen). Den Halte- bzw. Grenzton C übernimmt er aber dabei offenbar doch der Tradition der Musica enchiriadis, denn der dort in Bezug auf den unter ihm liegenden Tritonus kritische Ton E, der den Grenzton begründet, besitzt in Guidos System nun eine reguläre reine Quart.
Mit seiner Lehre vom Schließen profiliert Guido zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit die Rolle der Finales für die Modi. So lässt sich das von beiden Traktaten gelehrte Organum zum einen als das unbewegliche parallele Organum in der Unterquint bzw. Unterquart mit optionalen Oktavierungen, das Guido als modus durus bezeichnet, beschreiben; zum anderen als eine variable Begleitung in der Unterquart mit organalen Grenztönen und dem cantus im Mittelpunkt, nach Guido ein modus mollis.
Neben dem Winchester-Tropar, GB-Ccc (Cambridge, Corpus Christi College) 473, haben sich für die Form des variablen Quartorganums teilweise frühere Einzelstücke erhalten: In einer Handschrift aus dem Grenzgebiet des nordwestlichen Deutschland, der Niederlande und des nordöstlichen Frankreich (GB-Lbl Harley 3019, f. 56v, 1. Hälfte 10. Jahrhundert: Organum Sancte Bonifati) und in Handschriften aus Fleury , Saint-Maur-des-Fossés und Chartres.
Auffallend sind im Winchester-Tropar die Organa zu Tractus, die sonst nirgends belegt sind, sowie die Wertung des klanglichen Schmucks der Organa in der einleitenden Rubrik der Handschrift als »honigsüße Weisen« ([f. 135r: melliflua organorum modulamina super dulcissima celestia preconia]). Die Organalstimmen sind in einem anderen Teil der Handschrift aufgezeichnet als die Grundstimmen und letztere auch nur unvollständig. Als Ersatz kann die Handschrift GB-Ob Bodl. 775 dienen, ein um 1050 nach einer Vorlage um 980 gefertigtes Graduale, Tropar, Sequentiar und Prosar . Die Notation beider Quellen verwendet eine adiastematische Neumenschrift nach westfränkischen Vorbildern, mit der Virga als relativem Hochton und dem Punctum als relativem Tiefton und litterae significativae (e, i, l, s, t, m) als verdeutlichenden Zusätzen. Letztere sind bei der Organalstimme besonders zahlreich, offenbar in dem Bemühen, eine im Gegensatz zur Choralstimme nicht aus einer langen Tradition bekannte Melodie in ihren Details leichter wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die Buchstaben x für simplex und d für duplex markieren die einzelnen oder zu wiederholenden Abschnitte der Organa. Obwohl die Organa von Winchester nicht eindeutig in Tonhöhen lesbar und deshalb nur bis zu einem gewissen Grad rekonstruierbar sind (Edition Holschneider 1968, Rankin 2007), lassen sich doch aufgrund der Neumennotierung einige Beobachtungen machen: Die Vorherrschaft der Zeichen Punctum und Virga weist auf die Bedeutung des Einzeltons und damit des einzelnen intervallischen Zusammenklangs der symphoniae beim frühen Organum hin. In der Organalstimme lässt sich als Schlusswendung und auch zur Zwischengliederung die sterotype Folge Punctum-Oriscus-Virga feststellen, die mit der ebenso regelmäßigen und für Sequenzmelodien besonders typischen Schlussformel Climacus-Bivirga oder dem Pes stratus in der cantus-Stimme korrespondiert und das Zusammenlaufen der Stimmen in den Einklang am Schluss oder am Ende von Abschnitten abbildet. Die zahlreichen Gruppen von Punctum-Zeichen auf gleicher Höhe scheinen schließlich die repetierten Haltetöne des Organums auf den Grenztönen anzuzeigen. Auffallend ist bei den Schlussbildungen, wie die vox organalis oft zunächst zum letzten cantus-Ton in Sekunddissonanz verharrt und erst dann durch einen Sekundschritt nach oben, nachschlagend zum Einklang findet.
Bsp.: Diese typischen Charakteristika weist auch das folgende Organum aus Saint-Maur-des-Fossés, F-Pn lat. 12585 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422977w/f615>, um 1095 auf: Die in der Handschrift über dem Cantus notierte, klanglich aber unter ihm liegende Organumstimme beschränkt sich auf die Töne C, D, E, verwendet C als Grenz- und Halteton beim occursus auf D, D beim occursus auf E. Der Schluss-occursus wird entgegen der Lehre Guidos über die Intervallfolge Quarte - kl. Terz - Einklang erreicht:
 Intonation des Responsoriums Petre amas me, F-Pn lat. 12585, f. 306r
(Tonhöhenrekonstruktion der diastematischen Neumen: Stefan Morent).
Intonation des Responsoriums Petre amas me, F-Pn lat. 12585, f. 306r
(Tonhöhenrekonstruktion der diastematischen Neumen: Stefan Morent).
Der »Mailänder« Organumtraktat (I-Ma [Mailand, Biblioteca Ambrosiana], M 17 supra, f. 56–58v) besteht aus einem Prosa- und einem Vers-Teil, der die Lehre des ersten Teils in Merkversen paraphrasiert. In dieselbe Tradition gehören auch der Organumtraktat von Montpellier und der Traktat De Musica (Affligemensis) von Johannes (Affligemensis) , der um 1100 zwar in etwa dasselbe Klangbild wie der Mailänder Traktat beschreibt, aber aus einer anderen Lehrtradition stammt und nur ungefähre und sehr kurz gefasste Regeln (breviter et succincte) gibt. Das musikalische Repertoire des Mailänder Traktats besteht wie beim älteren Organum aus Kyrie-Tropen , Benedicamus Domino-Rufen, solistischen Teilen des Alleluias und einem Responsorium. Eine neue Qualität entsteht vor allem durch das Klangwertungsprinzip, nach dem die Zusammenklänge in konjunkte = Einklang und Oktav und disjunkte = Quart und Quint und in beliebige consonantiae = Terz und Sext eingeteilt werden. Diese Klänge werden auf bestimmte Teile eines Klangabschnitts verteilt, so dass der Beginn (prima vox) konjunt oder disjunkt sein kann, im Mittelteil (mediae voces) die disjunkten Klänge 5 und 4 im Wechsel folgen und der Schluss (duae ultimae voces) immer konjunkt endet und stets in Gegenbewegung durch eine beliebige consonantia erreicht wird, was als copula oder copulatio bezeichnet wird. Das typische Klangwechselprinzip in der Mitte (organum est vox sequens praecedentem sub celeritate diapente vel diatessaron) schließt allerdings die Möglichkeit von Parallelführung und die Verwendung von Terzen und Sexten nicht völlig aus. Der cantus wird durch die Anwendung dieser Regeln markiert und durch die copulae in klangliche Abschnitte gegliedert. Diese sind meist mit der Gliederung des cantus in Wortgrenzen oder Sinneinschnitte, die auch durch senkrechte Abteilungsstriche in der Handschrift deutlich gemacht werden, kongruent. Es kommen auch kürzere, rein musikalische Untergliederungen vor, wobei minimal zwei Klänge für die Erzeugung einer copula notwendig sind.
Die Tendenz zur Emanzipation der Organalstimme findet einen Rückhalt im Traktat von Montpellier , der die diaphonia als duplex cantus definiert. Hierzu gehört auch, dass sich die Organalstimme gegenüber dem älteren Organum meist über der cantus-Stimme bewegt und Stimmkreuzungen und Gegenbewegung sehr häufig sind, wenn auch nicht, wie bei Johannes, als Regel formuliert.
Die copula zeigt gegenüber der älteren Occursus-Lehre nun das Prinzip des Schließens durch Übergang von einem niedrigeren (penultima) zu einem höheren (ultima ) Konsonanzgrad, was für die gesamte spätere Kontrapunktlehre konstitutiv werden wird, und Terz und Sext werden als verfügbare Klänge mit einbezogen. Die Beispiele des Traktats zeigen drei verschiedene Fassungen eines Benedicamus Domino, ein »erfundenes« Organum über den einleitenden Satz der Organumlehre Hoc sit vobis iter (ad organum faciendum), fünf Versionen für die Intonation des Alleluias Iustus ut palma und das Kyrie Cunctipotens genitor (GT 725).
Bsp.: Beim Alleluia Iustus ut palma (Organum) (Edition Eggebrecht/Zaminer 1970, S. 53) sind nur die solistischen Teile mehrstimmig gefasst, der Alleluia-Iubilus und der Schluss des Verses sind einstimmig zu ergänzen: Die wiederholten Partien im Melisma über dem Wort ce-drus sind ebenfalls ausgelassen. Die verschiedenen Möglichkeiten für die organale Ausführung der Alleluia-Intonation unterscheiden sich z.B. duch konjunkte und disjunkte Anfangs-Intervalle: So zeigt die folgende Variante nach dem Beginn in der Oktave den Wechsel von Quinte und Quarte über –le und zum Abschluss der Silbe das Zusammentreffen der Stimmen im Einklang. Nach der erneuten Oktave zu Beginn der neuen Silbe –lu folgen dann aber drei Quinten hintereinander, gefolgt von zwei Quarten und dem abschließenden Einklang:
| c | a | b | G | F | e | c | d | c | a | b | G |
| C | D | F | D | F | E | F | G | F | E | F | G |
| Al- | le- | lu- | ia |
Das Organum-Beispiel für den Vers zeigt Klangzeilen entsprechend den Textabschnitten, aber auch zahlreiche Unterglieder. Die Organalstimme bewegt sich vorwiegend über dem cantus, außer bei ut palma, wo Stimmkreuzung durch den Bewegungsverlauf des cantus hervorgerufen wird, ansonsten lassen sich Parallel- und Gegenbewegung beobachten. Bei der Silbe ce- tritt die Terz auf, bei -drus die copula-Verbindung 6–8. Beim Kyrie Cunctipotens genitor (Edition Eggebrecht/Zaminer 1970, S. 50) sind nur die ersten der jeweils drei tropierten Anrufungen mehrstimmig gefasst, so dass auch hier die übrigen Rufe choraliter auszuführen sind. Die Klangabschnitte beginnen konjunkt oder disjunkt, die Schlusssilben leyson sind immer als copula gestaltet. Die Organalstimme liegt hier immer oberhalb und es herrscht überwiegend Gegenbewegung vor. Vermutlich handelt es sich auch bei diesem Beispiel nur um einen Gerüstsatz.
In den Kontext des neuen Organums um 1100 gehört auch eine Traktat-Gruppe von »Klangschrittlehren«, die sich vom Prinzip der Klangzeile abwenden und das Organum anhand elementarer Klangschritte lehren, indem Regeln dafür formuliert werden, wie die Organalstimme über einem bestimmten Intervallschritt des cantus zu agieren hat.
Neben den Handschriften aus St. Martial und dem Codex Calixtinus überliefern weitere Handschriften einzelne Beispiele für diese Form des Organums als Nachträge: So zwei mehrstimmige Stücke in einem Antiphonar und Tonar aus Lucca (Biblioteca Capitolare Feliniana 603) aus dem 12. Jahrhundert (f. 243: Eia canentes/Benedicamus Domino [Edition: Schneider 1935, Anhang, S. 35-36]; f. 256r: Benedicamus Domino-Tropus Regi regum glorioso) und ein zweistimmiges Alleluia O quam pulchra est in Buchstabennotation als Nachtrag des 12. Jahrhunderts in einem Traktat aus dem 11. Jahrhundert (F-AUT 46, f. 63). Die Beispiele lassen Oktav und Einklang als sehr stabile Intervalle, Quint und Quart als weniger stabile, Terz als instabile und Sekund und Sept nur als Durchgangsintervalle erkennen.
Das typische Kennzeichen der Handschriften aus St. Martial ist die diastematische aquitanische Neumenschrift mit geritzten Linien, wie sie bereits im Graduale von St. Yrieix zu beobachten ist.
Die Überlieferungsform mit ursprünglich einzelnen, kleineren Einheiten von Pergamentblättern, die nur eine oder wenige Lagen enthielten, ist für das Mittelalter durchaus nicht untypisch. Oft wurden diese dann erst später zu einem gemeinsamen Codex zusammengefügt:
- F-Pn lat. 1139, Ende 11. Jahrhundert (A)
- F-Pn lat. 3549, 12. Jahrhundert (B)
- F-Pn lat. 3719, 12. Jahrhundert (C)
- GB-Lbl add. 36881, Anfang 13. Jahrhundert (D)
Die Aufzeichnungsweisen der Zweistimmigkeit bestehen zum einen in »Partitur«-Anordnung, also aus zwei untereinander angelegten, durch eine rote Linie getrennten Systemen mit Schlüssel und Custoden. Zum anderen darin, dass die beiden Stimmen, wie bei dem Benedicamus Domino-Tropus Noster cetus psallat letus neben der Partiturnotation (GB-Lbl add. 36881, f. 5-6) auch in einer Version mit sukzessiver Notation, also mit den Stimmen hintereinander angeordnet, aufgezeichnet wurden und so zunächst den Eindruck von Strophen mit verschiedenen Melodien erwecken (F-Pn lat. 1139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000946s.r=1139.langDE>, f. 61r–61v; F-Pn lat. 3719 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502489w.r=3719.langDE> , f. 30r–31r). Die vox organalis wird aber bei solchen Fällen »versteckter Mehrstimmigkeit« teilweise durch rote Tinte oder kleine Kreise kenntlich gemacht. Eine weitere Aufzeichnungsweise findet sich etwa bei dem zweistimmigen Benedicamus Domino-Versus Stirps Iesse florigeram , bei dem die gedehnten Töne der cantus-Melodie, die aus dem Melisma über flos filius aus dem Responsorium Stirps Iesse gewonnen wurde, mit Tonbuchstaben unterhalb des Systems der Oberstimme notiert sind (F-Pn lat. 1139, f. 60v–61r).
Die Organalstimme liegt fast immer über dem cantus und die Intervalle 1, 8, 4, 5 erscheinen als Stützen der klanglichen Konstruktion, oft in den typischen Gegenbewegungsmustern 1->5->8, 5->1, 4->2->1, 3->1, 1->4, 1->5, an den Kadenzstellen auch 5->6->8. Der Zusammenhang mit der zeitgleichen theoretischen Tradition wie etwa im Mailänder Traktat ist zwar durchaus vorhanden, es bleiben jedoch auch Unklarheiten. So können die Anfänge der Silben konsonant oder dissonant sein, die Enden sind zu 70% konsonant. Dieser Befund lässt darauf schließen, dass es sich um eine Form der Mehrstimmigkeit handelt, die aus dem sängerischen Vollzug heraus entsteht: Der Anfang ist zunächst nicht festgelegt, er entsteht durch Umspielung, dann schließt der Sänger der Organalis aber im Hören mit dem Sänger des cantus auf einem konsonanten Klang. Es handelt sich also nicht im engeren Sinne um eine »schriftliche« Komposition.
Das Gesangsrepertoire des Codex Calixtinus, E-SC (Santiago de Compostela, Catedral Metropolitana), ist vermutlich französisch beeinflusst und vielleicht im Umkreis von Cluny oder Vézelay kompiliert worden. Darauf deuten auch die Verwendung zentral- bzw. nordfranzösischer Neumen und nicht der sonst in Spanien üblichen aquitanischen Notation und die namentlichen, aber nicht weiter zu verifizierenden Zuschreibungen an zum Teil historische Persönlichkeiten aus Frankreich (z.B. Congaudeant catholici an Magister Albertus Parisiensis /Albertus Stampensis, der 35 Jahre (ca. 1133- ca. 1177) an Notre Dame in Paris als Nachfolger von Adam von St. Victor tätig war und 1161 bei der Krönung Ludwigs VII. mitwirkte) hin. Die meisten Stücke sind in Partiturform notiert, d.h. in zwei Liniensystemen untereinander, nur beim letzten Stück (Ad honorem , f. 219v (alternative Zählung: 190v)) sind die beiden Stimmen wie bei einigen Stücken des St. Martial-Repertoires hintereinander notiert.
Das Repertoire des Codex Calixtinus gliedert sich in einstimmige lateinische Versus, oft als Benedicamus Domino-Tropen im Stil von St. Martial mit sehr eingängiger Melodik und Refrains (z.B. Exultet caeli curia ) und 22 mehrstimmige Gesänge. Diese bestehen aus fünf sehr melismatischen Responsorien (z.B. Iacobe virginei ), dem All. Vocavit Ihesus , sechs tropierten und drei untropieren Benedicamus Domino, zwei Kyrie-Tropen (darunter wiederum Cunctipotens genitor ), zwei Stücken mit bisher ungeklärter Funktion und aus zwei erstmals als Conductus bezeichneten Gesängen (z.B. Iacobe sancte ). Die Texte der Conductus und der Benedicamus-Tropen sind in Versform, während die Responsorien keine metrische Form aufweisen. Entsprechend sind die Stücke mit metrisch gebundenem Text im Note-gegen-Note-Satz und Schlussmelismen gefasst, die freien Texte dagegen mit einer stark melismatischen Organal-Stimme über gehaltenen cantus-Tönen. Die beiden Satztypen werden im Kontext der Schule von Notre Dame als discantus bzw. organum purum bezeichnet werden.
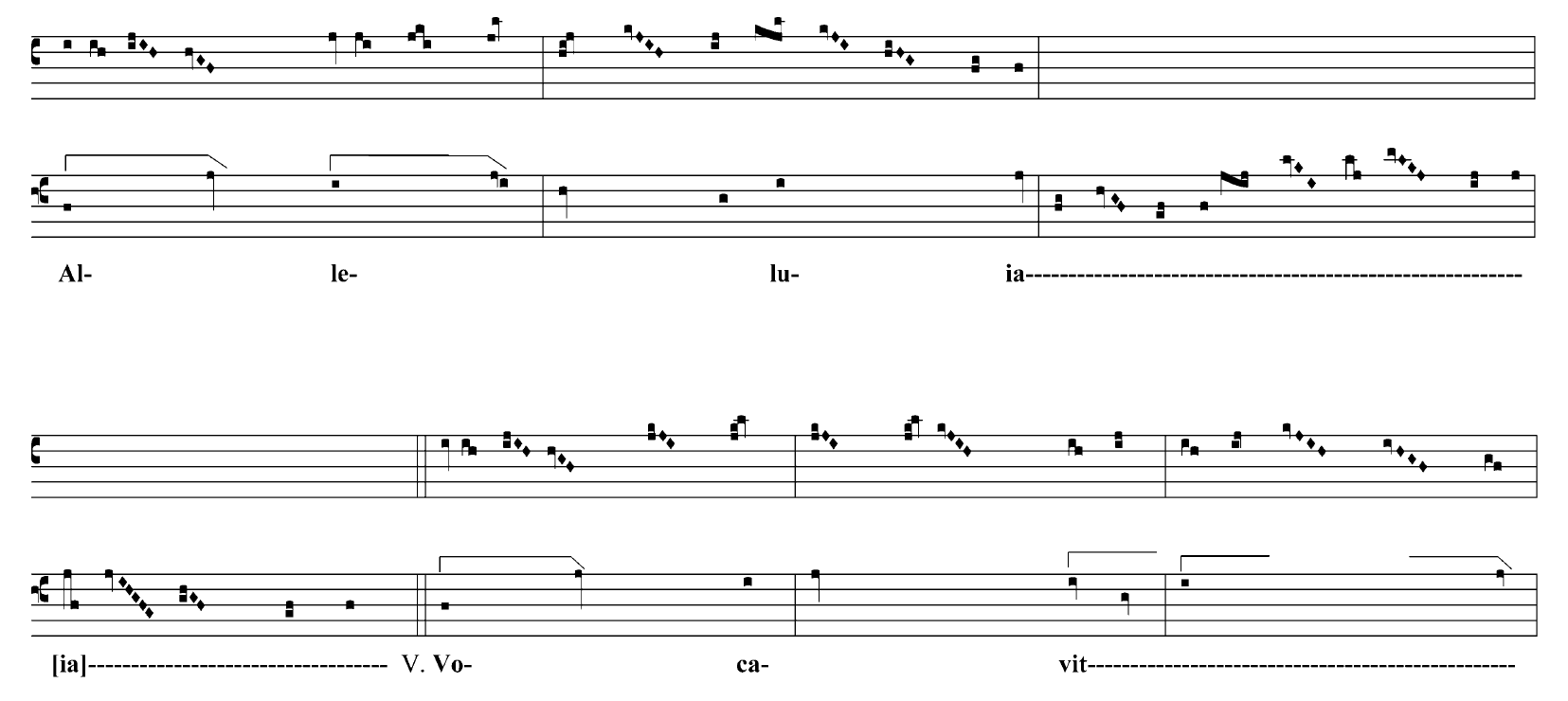
Beginn des Organum Alleluia Vocavit Ihesus (Codex Calixtinus, f. 189v) mit melismatischer Organalstimme über gehaltenen cantus-Tönen (Transkription Stefan Morent).
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Stück Congaudeant catholici (f. 214 (185)), das mit drei Stimmen notiert ist: Zum Cantus und der sehr melismatischen Oberstimme wurde in roter Farbe eine einfache zusätzliche Stimme hinzugefügt, über deren Funktion als alternative zweite Stimme oder wirkliche dritte Stimme in der Forschung lange kontrovers diskutiert wurde. Da die dritte rote Stimme zwar nachträglich hinzugefügt wurde und offenbar von einem anderen Schreiber, aber immer noch aus derselben Zeit zu stammen scheint und auch die sich ergebenden Dissonanzen durchaus vergleichbar zum St. Martial-Repertoire sind, scheint es sich hierbei mit größter Wahrscheinlichkeit tatsächlich um die erste dokumentierte dreistimmige Komposition zu handeln:
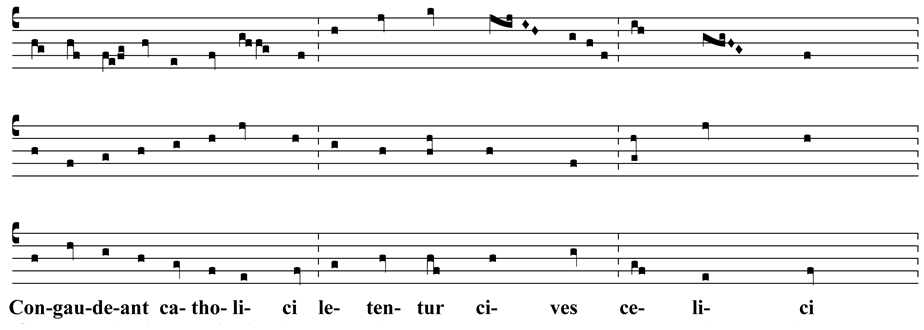
Beginn des Conductus Congaudeant catholici (Codex Calixtinus, f. 214 (185); Transkription Stefan Morent).
Zum ersten Mal direkt ins Wort erhoben wird die Dreistimmigkeit dann wohl im dreistimmigen Conductus Trine vocis tripudio aus dem Notre Dame-Repertoire (Codex W1, f. 68v–70r).
Bsp.: Wie beim Repertoire aus St. Martial ist auch hier der Zusammenhang mit der zeitgenössischen theoretischen Tradition nicht klar. Vergleicht man etwa das im Mailänder Traktat als Beispiel gegebene Kyrie Cunctipotens genitor mit demjenigen im Codex Calixtinus (f. 219r (190)), Edition van der Werf 1993, Bd. 2, S. 212–213), so entstehen hierbei Unsicherheiten durch die Fragen, welche Töne bei den hoch melismatischen Oberstimmen bei einem Prozess der Entkolorierung als Gerüsttöne für die klangliche Organisation zu gelten haben, ob überhaupt von einem vorgängigen einfachen Gerüstsatz auszugehen ist und wie die Oberstimme mit dem cantus genau zu koordinieren ist. Trotz dieser Unklarheiten verwenden beide Kompositionen offenbar nur die Gerüst-Klänge 1, 8, 4, 5 und setzen als Gestaltungsmittel Klangabschnitte mit konjunktem oder disjunktem Beginn und konjunktem Schluss ein. Unterschiede zeigen sich in der Verwendung von Folgen konjunkter Klänge wie 8->1->8 und in der durchgängig kolorierten Oberstimme.
Eventuell könnte ein Bindeglied zwischen dem Mailänder Traktat und dem im St. Martial-Repertoire und im Codex Calixtinus dokumentierten Stand der Mehrstimmigkeit im sogenannten Adrien de la Fage-Traktat vorliegen, der wohl im 12. Jahrhundert verfasst wurde, aber erst in italienischen und spanischen Quellen des 14. Jahrhunderts überliefert ist. Er lehrt die Trennung von Organum mit melismatischer Oberstimme und Discantus mit Note-gegen-Note-Satz und beschreibt außerdem einen dreistimmigen Satz aus cantus simplex, discantus simplex und organum, der die einzige Möglichkeit für eine nicht durch fixierte Rhythmik geregelte Dreistimmigkeit darstellt.
Als Beispiel für die Klangschritt-Regeln des Vatikanischen Organum-Traktats (mit dem Incipit Ars organi [I-Rvat fondo Ottoboniano lat. 3025, f. 46–50v]) folgt hier die erste Regel:
I. Regula. Si cantus ascenderit duas uoces et organum incipiat in dupla descendat organum 3 uoces et erit in quinta vt:
(»Erste Regel. Wenn der Cantus zwei Töne [= eine Sekunde] ansteigt und das Organum beginnt in der Oktav, so steigt das Organum um drei Töne [= eine Terz] herab und endet auf der Quint, wie hier:«)
Ein notiertes Beispiel hierzu illustriert den melismatisch verzierten Schritt mit einem sequenzierend absteigenden Motiv von der Oktav zwischen cantus-Ton c (fa) und der Organalstimme auf c' zur Quinte über dem cantus-Ton d (re) und der Organalstimme auf a.
Die vollständigen Beispiele am Ende des Traktats, wie das All. Hic Martinus (f. 49), entstammen wiederum den solistischen Teilen der responsorialen Gesänge für Messe und Offizium. Hierbei beginnt die vox organalis typischerweise vor dem ersten cantus-Ton mit einer stereotypen, verzierenden Initialformel aus einer Dissonanz heraus (Anonymus 4: principium ante principium, elongationem florificandam) und entfaltet dann über dem ersten Halteton des cantus ihr Melisma. Dieses beendet der Organizator mit dem Wechsel zum nächsten Halteton des cantus und setzt nach einer Atempause mit dem nächsten Melisma an.
Als weitere Überlieferungszeugen des Notre Dame-Repertoires wären so unterschiedliche Handschriften wie der Codex Las Huelgas, die Handschrift E-Mn (Madrid, Biblioteca Nacional) 20486, CH-SGs 383 (vermutlich aus Lausanne ), CH-EN (Engelberg Stiftsbibliothek) Cod. 314, Fragmente mit Organa aus dem Magnus liber in einem franziskanischen Graduale aus dem Klarissenkloster der Hl. Kunigunde in Stary Sącz (Polen) (PL-STk 2) und F-Pn lat. 15139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139> aus St. Victor in Paris zu nennen, die die Rezeption des Notre Dame-Repertoires auch an peripheren Orten belegen. Zahlreiche weitere Quellen zum Notre Dame-Repertoire sind wahrscheinlich verloren.
Stilistisch werden bei syllabischen Einzeltönen des cantus diese zu gehaltenen cantus-Tönen mit einer freirhythmischen melismatischen Organalstimme, was der Theoretiker Johannes de Garlandia (2. Viertel 13. Jahrhundert) in dem ihm zugeschriebenen Traktat De mensurabili musica als organum duplum oder organum per se bezeichnet (von Franco von Köln und Anonoymus 4 dem organum purum zugerechnet). Offenbar sollte hier das System der rhythmischen Modi in der Oberstimme (noch) nicht angewandt werden, auch wenn hierüber in der Forschung (und entsprechend in modernen Editionen) kontroverse Meinungen herrschen. Bei hochmelismatischen Partien des cantus entstehen dagegen sogenannte Discantus-Partien (clausulae sive punctae), ein Note-gegen-Note-Gerüstsatz in ternärer Messung in beiden Stimmen, wobei der 1. rhythmische Modus vorherrscht. Dabei können die hierzu gehörigen cantus-Abschnitte auch wiederholt werden und, wenn Schlusston des ersten Durchlaufs und Anfangston des zweiten in Eins fallen, verschiedene melodisch-rhythmische Strukturierungen desselben Tonmaterials vorführen. Offenbar lag hierin einer der künstlerischen Ansprüche der Discantus-Partien.
Organum duplum Viderunt omnes von Leonin ?, [I-Fl Cod. Plut. 29.1 <http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOHy_N-I1A4r7GxMB57&c=Antiphonarium#/book>, f. 99r-v): Beginn des Verses mit Halteton- und Discantus-Partien (Transkription Stefan Morent).
Perotin soll den Magnus liber überarbeitet haben, indem er Melismen kürzte (abbreviavit), die organum purum-Partien durch Discantus-Partien ersetzte und Ersatzklauseln mit mehrfachem Tenor-Durchlauf für die bereits vorhandenen Klauseln schuf. Außerdem steigert er die Mehrstimmigkeit über die bisherige Zweistimmigkeit hinaus zur Drei- und Vierstimmigkeit, indem er zum Duplum ein Triplum und Quadruplum hinzufügt. So lässt sich z.B. beim Organum duplum All. Pascha nostrum (Organum) (Edition Tischler 1988, Bd. 2, S. 906–935) beobachten, wie im Vergleich zur Fassung in W1 (f. 27v–28r) in der Überlieferung in F (f. 109) und W2 (f. 72r–72v) zunehmend Discantus-Partien Verwendung finden. Die Formulierung abbreviavit muss aber nicht unbedingt auf eine rein zeitliche Kürzung zielen, sondern könnte auch den Vorgang der Umformulierung im Zeichen neuer kompositorischer Vorstellungen und Mittel bezeichnen. Ob fortschreitende Entwicklungslinien (etwa von länger zu kürzer) zwischen den Handschriften nur aufgrund ihrer Datierung gezogen werden können, ist zu bezweifeln.
Bei den Organa tripla, wie den Perotin zugeschriebenen All. Nativitas (F, f. 31r–32v, W1, f. 6r–7v, W2, f. 16r–17v, Edition Roesner 1993, S. 143–150) und All. Posui adiutorium (F, f. 36r–37v, Edition Roesner 1993, S. 189–194), und den Organa quadrupla, wie den berühmten, ebenfalls vom Anonymus 4 Perotin zugeschriebenen Gradualien Viderunt omnes (F, f. 1r–4r, W1, f. 3r–3v, Edition Roesner 1993, S. 1–14) und Sederunt principes (F, f. 4r–7v, W2, f. 1r–4v, W1, f. 3v–6v, Edition Roesner 1993, S. 15–29), wird der Schichtbau deutlich, der die Stimmen vom cantus ausgehend übereinander setzt, wobei die obersten auch wegfallen könnten. Es wäre durchaus ebenso denkbar, dass die überlieferte kunstvolle Textierung Vide prophecie finem adimplete (W2, f. 167r–168r) von Philipp dem Kanzler (gest. 1236) zum Duplum von Perotins Organum quadruplum Viderunt den Ausgangspunkt von Perotins Komposition bildete, über die er weitere Stimmen schichtete, als nur von einer nachträglichen Textierung durch Philipp den Kanzler auszugehen.
Die Oberstimmen weisen zahlreiche Wiederholungen, kanonische Führungen, Variationen und Sequenzierungen rhythmisch-melodischer Figuren sowie Stimmtausch auf. Da sie sich alle in der ungefähr gleichen Lage bewegen, entsteht so eine besonders dichte Textur. Solche Techniken versteht Johannes de Garlandia wohl unter dem Terminus color bzw. colores. Es handelt sich nicht um Mehrstimmgikeit im Sinne von kontrapunktisch geführten unabhängigen Stimmen, sondern um statische Klangräume über zeitlich maximal gedehnten Haltetönen des Chorals. Durch dieses völlige Übergewicht der klanglichen Auszierung und Ausdeutung hat die Lösung des Chorals aus seinem ursprünglichen melodischen Zusammenhang an diesen Stellen einen ersten Höhepunkt erreicht. Es darf aber nicht vergessen werden, dass der einstimmge Choral in seiner ursprünglichen Form an den Stellen, die nicht mehrstimmig gefasst wurden, weiter erklingt. Im Ganzen werden also nur bestimmte exponierte Stellen, die solistischen Partien, die von Anfang an das Interesse mehrstimmiger Formen auf sich zogen, klanglich maximal hervorgehoben: Durch die Haltetöne, die statischen Klangräume und ihre schiere Länge erscheinen sie gleichsam der Zeit enthoben.
Beginn des Organum quadruplum Viderunt omnes von Perotin: I-Fl Cod. Plut. 29.1 <http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOHy_N-I1A4r7GxMB57&c=Antiphonarium#/book>, f. 1v
(Transkription Stefan Morent).
Dies alles dient dem Anliegen, das die Mehrstimmgkeit innerhalb des liturgischen Gesangs von Beginn an verfolgt: Die Erweiterung und Erhöhung der Feierlichkeit, wie es der Magnus liber bereits in seinem Zusatz formuliert: pro servitio divino multiplicando. Dem entspricht, dass auch andere Parameter der Liturgie, wie etwa die Zahl der Kleriker und deren Rang bis hin zur Sauberkeit ihrer Tonsur, die Zahl und das Gewicht der Kerzen, die Kostbarkeit der Gewänder und die Menge an Weihrauch aufs Äußerste gesteigert wurden.
Die entscheidende Neuerung der Modalnotation, die dem geistigen Neuaufbruch in Paris im späten 12. Jahrhundert zu verdanken ist, besteht darin, dass unabhängig vom Silbenwert eine rein musikalische Zeiteinheit als tempus definiert wird, wodurch sich klar definierte proportionale Zeitdauern darstellen lassen. Das Neue besteht also nicht darin, dass es Längen und Kürzen gibt, sondern dass diese gegenüber vorhergehender Musik durch eine Maßeinheit genau gegenseitig definiert sind (Johannes de Garlandia: aequipollentia). Das tempus entspricht dem kleinsten Einzelwert der Brevis und ermöglicht es, Musik aus sich heraus, ohne Bindung an äußere Faktoren zu struktrieren: Musik wird messbar und damit zur musica mensurabilis . Letztlich ist damit der Weg zur Herauslösung der Musik aus dem bisher allein bestimmenden Zeitgerüst des Kirchenjahrs und der Liturgie vorgezeichnet. Dies scheint auch im Dekret von Papst Johannes XXII. mitzuschwingen, wenn er die geradezu Besessenheit oder Anmaßung der »novellae scholae discipuli«, die Zeit messen zu wollen (»temporibus mensurandis invigilant«), geisselt.
Folgen von lauter Longen (5. Modus: 3+3+ …) bleiben immer dreizeitig, ebenso bleibt eine Folge lauter Breven (6. Modus: 1+1+1, 1+1+1, …) immer beim kleinsten Einzelwert des Systems. Folgt auf die Longa eine Brevis (1. Modus: 2+1, 2+1, …) oder auf die Brevis eine Longa (2. Modus: 1+2, 1+2, …), so verkürzt sich die Longa um einen Einzelwert, wird also zweizeitig, und bildet zusammen mit der Brevis wieder eine perfectio. Stehen zwischen zwei Longen zwei Breven, so sind beide Longen dreizeitig und die zweite Brevis wird um einen Einzelwert erweitert, also zweizeitig, um zusammen mit der ersten Brevis wieder eine perfectio zu bilden (3. Modus: 3+1+2, 3+1+2, … und 4. Modus: 1+2+3, 1+2+3, …; 1 = Brevis , 3 = perfekte Longa, 2 = imperfekte Longa oder verdoppelte Brevis). Auch die Pause (vox omissa) erhält erstmals einen eigenen messbaren Wert. Das vollständige System der sechs rhythmischen Modi scheint mehr Ausdruck des scholastisch-logischen Denkens und Durchdeklinierens von Möglichkeiten zu sein, als dass es der tatsächlichen musikalischen Praxis in vollem Umfang entspricht. Jedenfalls lassen lassen sich nicht alle Modi bzw. nicht in derselben Frequenz im notierten Repertoire ausfindig machen.
Die Modi geben sich in der Notation durch die Abfolgen typischer Muster von Gruppeneumen in Ligaturen zu erkennen, so (Beispiele nach Johannes de Garlandia, rhythmische Äquivalente: = perfekte Longa, = imperfekte Longa oder verdoppelte Brevis, = Brevis, [ ] = Ligaturen)
der 1. Modus durch 3-2-2 … 2, z.B. [︱][︱][︱][︱][︱]
der 2. Modus durch 2-2-2 … 3, z.B. []︱[]︱[]︱[︱]
der 3. Modus durch 1-3-3 … 3, z.B. M [︱][︱][︱]
der 4. Modus durch 3-3-3 … 1, z.B. []︱[]︱[]︱[]︱
der 5. Modus durch 1-1-1 … 1 oder 3-3 … 3, z.B. ...
der 6. Modus durch 4-3-3 … 3, z.B. [︱][︱][︱]
Als Grundregel gilt, dass jede Binaria die Folge B-L repräsentiert. Der einzelne Notenwert lässt sich also nicht unabhängig aufgrund seiner graphischen Form, sondern nur im Kontext erschließen. Die Regelmäßigkeit wird nur unterbrochen durch Tonwiederholungen oder wenn die Longa-Werte am Ende von Ligaturen durch so genannte Plica-Zeichen, die, aus den Liqueszenz-Zeichen entstanden, in Einzelwerte aufgebrochen (fractio modi ) oder Einzelwerte zu einem größeren Wert zusammengezogen (extensio modi ) werden. Folgen von rhombischen Noten, sogenannte currentes , die vor allem im organum purum oft skalenartig eine ganze Oktav von oben nach unten durchlaufen, scheinen ebenfalls außerhalb der Modalrhythmik zu liegen und eher eine freie Verzierung anzuzeigen. Die elementaren Muster der jeweiligen Modi können in sogenannten ordines mehrfach wiederholt werden, um dann mit einer Pause, die die letzte perfectio auffüllt, zu enden. So stellt die Ligaturenfolge 3-2-2 + vertikaler Strich den 3. Ordo des 1. Modus dar = LB LB LB L B-Pause.
In der Redaktion des Magnus liber durch Perotin zeigt sich, dass das organum purum im Stil Leonins offenbar inzwischen unmodern geworden war. In den drei- und vierstimmigen Organa tripla und quadrupla sind auch die organalen Abschnitte Discantus-Sätze über langen Haltetönen. Anders hätte sich die Drei- und Vierstimmigkeit nicht koordinieren lassen. Zwischen organum purum und Discantus liegt nach Johannes de Garlandia die copula, die eine modal gemessene Oberstimme über nicht gemessenen Haltetönen bezeichnet. Die gegenüber dem St. Martial-Repertoire mögliche grundsätzliche rhythmische Strukturierung der Modalnotation bietet allerdings keine absolute Eindeutigkeit und Sicherheit bei der Übertragung und Interpretation der so notierten Musik: So bleibt die Interpretation der organum purum-Partien unklar und auch die Gruppennotierung der Modalnotation weist Ambivalenzen auf. Jede Edition dieses Repertoires, auch die hier gegebenen Übertragungen, schließt somit eigene Interpretationen des Editors ein, auf die allerdings hier nicht im Detail eingangen werden kann.
Der Conductus wird ein- bis vierstimmig vertont und zeigt die typische Stimmenschichtung der Organa. Insgesamt sind im Zeitraum zwischen 1180 und 1320 ca. 800 Conductus überliefert, wobei Paris und Notre Dame wiederum eines der Zentren der Überlieferung bildet. Codex F enthält 83 einstimmige, 130 zweistimmige, 59 dreistimmige und 3 vierstimmige Conductus. Zu unterscheiden sind rein syllabische Vertonungen (cum littera ) und solche mit melismatischen Partien (sine littera ), sogenannten caudae, wie im dreistimmigen Conductus Salvatoris hodie (Codex W2, f. 31r–33r), der von Anonymus 4 Perotin zugeschrieben wird. Die rhythmische Interpretation der syllabischen Partien, da sie sich als Einzeltöne im Gegensatz zu den melismatischen caudae nicht der Modalnotation bedienen können, bleibt hierbei allerdings unklar. Die caudae der Conductus erscheinen vor allem zu Beginn und zum Schluss und können wiederum textiert werden und sich vom Ursprungsgesang ablösen, wie z.B. die textierte Cauda Bulla fulminante vom Conductus Dic Christi veritas (Codex W1, f. 66r–66v, F, f. 203v–204r, W2, f. 33r–34v). Klanglich folgen die Conductus denselben Regeln wie die Organa, die perfekten Konsonanzen Oktav, Einklang, Quint und teilweise noch Quart bilden die strukturellen Schwerpunkte, unterbrochen und verbunden durch die imperfekten Konsonanzen Terz und Sext.
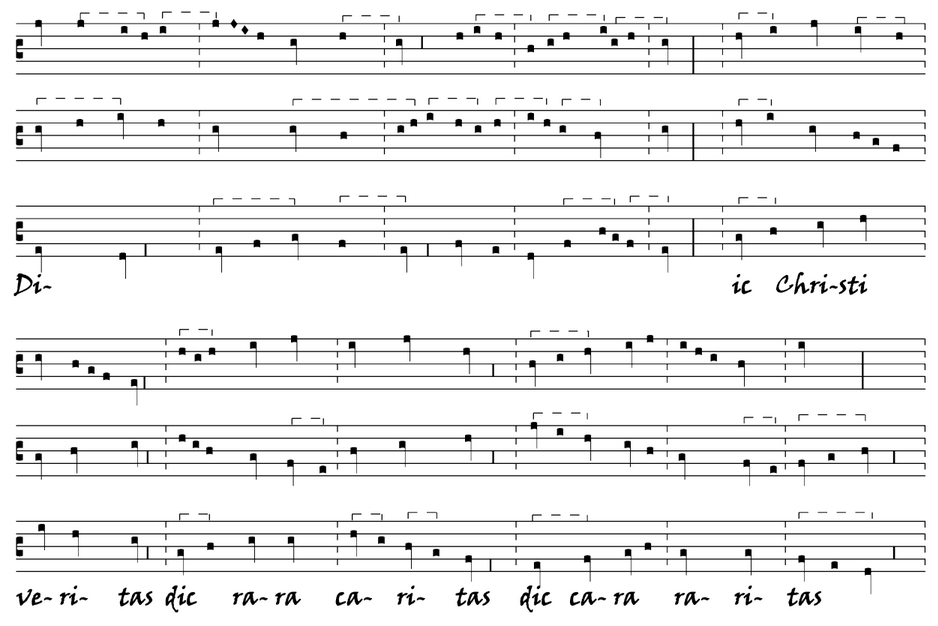
Die Anlage der Notre Dame-Handschriften als retrospektive Sammelhandschriften spricht dafür, dass die Bedeutung des Repertoires erkannt, dokumentiert und im Sinne einer scholastischen summa bewahrt werden sollte. Demonstrativ eröffnet Codex F mit einer ganzseitigen Illumination aus dem Pariser Atelier von Johannes Grusch zur Musik-Einteilung des Boethius gegenüber dem Beginn des Organum quadruplum Viderunt omnes von Perotin, dem Anonymus 4 eine »Farbenfülle der musikalischen Kunst« (habundancia colorum armonice artis) attestiert: Dem im Traktat von Boethius (und in der Darstellung der musica in der Miniatur) und in seiner Definition der musica transportierten Anspruch, das Ganze der Erscheinungsformen der Musik zu erfassen, wird die Musiksammlung der Handschrift mit demselben Anspruch gegenüber gestellt. Auch in einer illuminierten A-Initiale auf f. 314 findet sich eine Darstellung der artes liberales.
Die Rolle der Notation und von Schriftlichkeit wird hier zu einem wesentlichen Bestandteil der Komposition. Ein Hinweis darauf zeigt sich darin, dass das zwar Singbare aber früher nicht Notierbare nun nicht umgangen, sondern mit neuen Zeichen in Notation gebracht wird. So findet sich beim vierstimmigen Conductus Vetus abit littera (F, f. 10r–10v) zum ersten Mal ein fis-Vorzeichen und beim Organum duplum All. Pascha nostrum (W1, f. 28r) sowie beim Cento-Conductus Hac in die rege nato (W1, f. 166r) ein es-Vorzeichen. Inwieweit schriftliche Aufzeichnungen bei der Aufführung eine Rolle spielten, ist unklar. Die Größe der erhaltenen Handschriften scheint jedenfals nur zu Dokumentationszwecken ausreichend. Allerdings zeigt die Miniatur in der »S«-Initiale des dreistimmigen Conductus Salvatoris hodie in Codex W2 (f. 31r) drei Kleriker mit Tonsur, die gemeinsam aus einem Codex singen.
Die Kunst des Organums verschwindet nach der Notre Dame-Schule zwar als Hauptform der Mehrstimmigkeit, bleibt aber besonders in Randgebieten, wie z.B. in der in Deutschland belegten Praxis des Quintierens, teilweise noch bis ins 18. Jahrhundert, wie ein Brief Leopold Mozarts beweist, erhalten. Auch spätere Quellen des 13. und 14. Jahrhunderts, wie der Codex Las Huelgas mit 48 Organa (um 1300, z.B. Ab hac familia ) und der Codex CH-EN (Engelberg Stiftsbibliothek) Cod. 314 (um 1380) sowie polnische Quellen enthalten noch Überlieferungen der Organum-Tradition, vor allem bei verschiedenen Formen des mehrstimmigen Lektions- und Orationsvortrags, die allerdings aus einer lange tradierten mündlichen Praxis stammen. Elias Salomon beschreibt und illustriert 1274 in seinem Traktat Scientia seu doctrina artis musicae eine Form des vierstimmigen Singens in der super librum-Tradition in parallelen Quarten, Quinten und Oktaven als scientia organizandi.
Quellen
Organum Victime pascali laudes, F-Pn lat. 3549, f. 158v
All. Hic Martinus : I-Fl Cod. Plut. 29.1, f. 134r–v
Klausel Nusmido: I-Fl Cod. Plut. 29.1, f. 150v
Perotin: Klausel Mors: I-Fl Cod. Plut. 29.1, f. 7v
Quellentexte und Editionen
All. Hic Martinus: Tischler 1988, Bd. 2, S. 1373–1383
: Vatikanischer Organum-Traktat (Ars organi)
: Anonymus 4
Johannes de Garlandia: De mensurabili musica
Birnbaum, Stanley (Hrsg.), Johannes de Garlandia: Concerning measured music (De mensurabili musica), Colorado Springs 1978.
@book{Birnbaum.1978, year = {1978}, title = {Johannes de Garlandia: Concerning measured music (De mensurabili musica)}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Colorado Springs}, editor = {Birnbaum, Stanley} }Wagner, Peter, Die Gesänge der Jakobsliturgie zu Santiago de Compostela, Freiburg/Schweiz 1931.
@book{DGdJzSdCWagner, author = {Wagner, Peter}, year = {1931}, title = {Die Ges{\"a}nge der Jakobsliturgie zu Santiago de Compostela}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Freiburg/Schweiz} }Holschneider, Andreas, Die Organa von Winchester, Hildesheim 1968.
@book{DOvWHolschneider, author = {Holschneider, Andreas}, year = {1968}, title = {Die Organa von Winchester}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Hildesheim} }Eggebrecht, Hans Heinrich und Frieder Zaminer (Hrsg.), Ad Organum faciendum. Lehrschriften der Mehrstimmigkeit in nachguidonischer Zeit (Edition, Übersetzung, Kommentar), Mainz 1970.
@book{Eggebrecht.1970, year = {1970}, title = {Ad Organum faciendum. Lehrschriften der Mehrstimmigkeit in nachguidonischer Zeit (Edition, {\"U}bersetzung, Kommentar)}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Mainz}, editor = {Eggebrecht, Hans Heinrich and Zaminer, Frieder} }Everist, Mark (Hrsg.), Les organa à deux voix du manuscrit de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Plut. 29.1 (Le Magnus liber organi de Notre Dame), Monaco 2001-2003.
@book{Everist.20012003, year = {2001-2003}, title = {Les organa {\`a} deux voix du manuscrit de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Plut. 29.1}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Monaco}, volume = {2-4}, series = {Le Magnus liber organi de Notre Dame}, editor = {Everist, Mark} }Schneider, Marius, Geschichte der Mehrstimmigkeit. Historische und Phänomenologische Studien, Zweiter Teil: Die Anfänge in Europa. Mit 172 Notenbeispielen und 4 Handschriften-Wiedergaben als Anhang, Berlin 1935.
@book{GdMHuPSZTDAiEM1Nu4HWaASchneider, author = {Schneider, Marius}, year = {1935}, title = {Geschichte der Mehrstimmigkeit. Historische und Ph{\"a}nomenologische Studien, Zweiter Teil: Die Anf{\"a}nge in Europa. Mit 172 Notenbeispielen und 4 Handschriften-Wiedergaben als Anhang}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Berlin} }Husmann, Heinrich (Hrsg.), Die drei- und vierstimmigen Notre-Dame-Organa, Leipzig 1940.
@book{Husmann.1940, year = {1940}, title = {Die drei- und vierstimmigen Notre-Dame-Organa}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Leipzig}, editor = {Husmann, Heinrich} }Karp, Theodore (Hrsg.), The polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela, Bd. 1: Text, Bd. 2: Edition, Berkeley and Oxford 1992.
@book{Karp.1992, year = {1992}, title = {The polyphony of Saint Martial and Santiago de Compostela, Bd. 1: Text, Bd. 2: Edition}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Berkeley and Oxford}, editor = {Karp, Theodore} }Knapp, Janet (Hrsg.), Thirty-five Conductus for two and three voices, New Haven 1965.
@book{Knapp.1965, year = {1965}, title = {Thirty-five Conductus for two and three voices}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {New Haven}, editor = {Knapp, Janet} }Panofsky, Erwin (Hrsg.), Abbot Suger on the abbey church of St. Denis and its art treasures, Princeton 1946.
@book{Panofsky.1946, year = {1946}, title = {Abbot Suger on the abbey church of St. Denis and its art treasures}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Princeton}, editor = {Panofsky, Erwin} }Reaney, Gilbert und André Gilles (Hrsg.), Franco: Ars cantus mensurabilis (CSM), Rom 1974.
@book{Reaney.1974, year = {1974}, title = {Franco: Ars cantus mensurabilis}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Rom}, volume = {18}, series = {CSM}, editor = {Reaney, Gilbert and Gilles, Andr{\'e}} }Reckow, Fritz (Hrsg.), Der Musiktraktat des Anonymus IV, Wiesbaden 1967.
@book{Reckow.1967, year = {1967}, title = {Der Musiktraktat des Anonymus IV}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Wiesbaden}, editor = {Reckow, Fritz} }Reimer, Erich (Hrsg.), Johannes de Garlandia: De mensurabili musica. Kritische Edition mit Kommentar und Interpretation der Notationslehre, Wiesbaden 1972.
@book{Reimer.1972, year = {1972}, title = {Johannes de Garlandia: De mensurabili musica. Kritische Edition mit Kommentar und Interpretation der Notationslehre}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Wiesbaden}, editor = {Reimer, Erich} }Roesner, Edward H. (Hrsg.), Le Magnus Liber Organi de Notre Dame de Paris, Monaco 1993-2009.
@book{Roesner.19932009, year = {1993-2009}, title = {Le Magnus Liber Organi de Notre Dame de Paris}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Monaco}, editor = {Roesner, Edward H.} }Salomo, Elias, „Scientia seu doctrina artis musicae“ in: GS III , S. 16–64.
@incollection{Salomo., author = {Salomo, Elias}, title = {Scientia seu doctrina artis musicae}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, pages = {16--64}, booktitle = {GS III} }Thurston, Ethel (Hrsg.), The conductus collections of ms Wolfenbüttel 1099, Madison 1980.
@book{Thurston.1980, year = {1980}, title = {The conductus collections of ms Wolfenb{\"u}ttel 1099}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Madison}, editor = {Thurston, Ethel} }Tischler, Hans (Hrsg.), The Parisian two-part-organa. The complete comparative edition (Recent researches in the music of the Middle Ages and Early Renaissance), Stuyvesant and New York 1988.
@book{Tischler.1988, year = {1988}, title = {The Parisian two-part-organa. The complete comparative edition}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Stuyvesant and New York}, volume = {11-13}, series = {Recent researches in the music of the Middle Ages and Early Renaissance}, editor = {Tischler, Hans} }van der Werf, Hendrik, The oldest extant part music and the origin of Western polyphony, Rochester 1993.
@book{ToepmatooWpvanderWerf, author = {{van der Werf}, Hendrik}, year = {1993}, title = {The oldest extant part music and the origin of Western polyphony}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Rochester} }Planchart, Alejandro, The repertory of tropes at Winchester, Princeton 1977.
@book{TrotaWPlanchart, author = {Planchart, Alejandro}, year = {1977}, title = {The repertory of tropes at Winchester}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Princeton} }Waite, William G. (Hrsg.), The rhythm of twelfth century polyphony. Its theory and practice, New Haven 1954.
@book{Waite.1954, year = {1954}, title = {The rhythm of twelfth century polyphony. Its theory and practice}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {New Haven}, editor = {Waite, William G.} }Yudkin, Jeremy (Hrsg.), The music treatise of Anonymus IV. A new translation (MSD), Neuhause-Stuttgart 1985.
@book{Yudkin.1985, year = {1985}, title = {The music treatise of Anonymus IV. A new translation}, keywords = {OrganumUndConductus;Quellentexte}, address = {Neuhause-Stuttgart}, volume = {41}, series = {MSD}, editor = {Yudkin, Jeremy} }
Handschriften
CH-EN Cod. 314.
@book{CEC3, title = {CH-EN Cod. 314}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }CH-SGs 383.
@book{CS3f, title = {CH-SGs 383}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst. <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1099-helmst>
@book{DWCG1H, title = {D-W Cod. Guelf. 1099 Helmst.}, url = {http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1099-helmst}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }D-W Cod. Guelf. 628 Helmst. <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/628-helmst>
@book{DWCG6H, title = {D-W Cod. Guelf. 628 Helmst.}, url = {http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/628-helmst}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }E-Mn 20486.
@book{EM2, title = {E-Mn 20486}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }E-SC Codex Calixtinus.
@book{ESCC, title = {E-SC Codex Calixtinus}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }F-Pn lat. 1139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000946s.r=1139.langDE>
@book{FPl1c, title = {F-Pn lat. 1139}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000946s.r=1139.langDE}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }F-Pn lat. 15139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139>
@book{FPl1i, title = {F-Pn lat. 15139}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }F-Pn lat. 3549 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90660885/f1.image.r=3549.langDE>
@book{FPl3, title = {F-Pn lat. 3549}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90660885/f1.image.r=3549.langDE}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }F-Pn lat. 3719 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502489w.r=3719.langDE>
@book{FPl3b, title = {F-Pn lat. 3719}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502489w.r=3719.langDE}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }GB-Ccc 473 <https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537>
@book{GC4, title = {GB-Ccc 473}, url = {https://parker.stanford.edu/parker/catalog/yp193mg4537}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }GB-Lbl add. 36881.
@book{GLa3, title = {GB-Lbl add. 36881}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }GB-Lbl Harley 3019.
@book{GLH3, title = {GB-Lbl Harley 3019}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }GB-Ob Bodl. 775.
@book{GOB7, title = {GB-Ob Bodl. 775}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }I-Fl Cod. Plut. 29.1 <http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOHy_N-I1A4r7GxMB57&c=Antiphonarium#/book>
@book{IFCP21, title = {I-Fl Cod. Plut. 29.1}, url = {http://mss.bmlonline.it/s.aspx?Id=AWOHy_N-I1A4r7GxMB57&c=Antiphonarium#/book}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }I-Ma M 17 supra.
@book{IMM1s, title = {I-Ma M 17 supra}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }I-Rvat fondo Ottoboniano lat. 3025.
@book{IRfOl3, title = {I-Rvat fondo Ottoboniano lat. 3025}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }PL-STk 2.
@book{PS2, title = {PL-STk 2}, keywords = {Handschriften;OrganumUndConductus} }
Faksimilia
Baxter, James H. (Hrsg.), An Old St. Andrews Music Book (Cod. Helmst. 628), Faksimile-Ausgabe der Handschrift, Oxford and Paris 1931.
@book{Baxter.1931, year = {1931}, title = {An Old St. Andrews Music Book (Cod. Helmst. 628), Faksimile-Ausgabe der Handschrift}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Oxford and Paris}, editor = {Baxter, James H.} }Códex Calixtinus de la Catedral de Santiago de Compostela, Madrid 1993.
@book{CCdlCdSdC, year = {1993}, title = {C{\'o}dex Calixtinus de la Catedral de Santiago de Compostela}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Madrid} }Dittmer, Luther (Hrsg.), Madrid 20486. Facsimile reproduction of the manuscript (Publications of Mediaeval Musical Manuscripts), New York 1957.
@book{Dittmer.1957, year = {1957}, title = {Madrid 20486. Facsimile reproduction of the manuscript}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {New York}, volume = {I}, series = {Publications of Mediaeval Musical Manuscripts}, editor = {Dittmer, Luther} }——— (Hrsg.), Facsimile reproduction of the manuscript Wolfenbüttel 1099 Helmstadiensis (1206) (Publications of Mediaeval Musical Manuscripts), Brooklyn and New York 1960.
@book{Dittmer.1960, year = {1960}, title = {Facsimile reproduction of the manuscript Wolfenb{\"u}ttel 1099 Helmstadiensis (1206)}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Brooklyn and New York}, volume = {II}, series = {Publications of Mediaeval Musical Manuscripts}, editor = {Dittmer, Luther} }——— (Hrsg.), Facsimile reproduction of the manuscript Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteo 29.1 (Publications of Mediaeval Manuscripts), Brooklyn and New York 1966.
@book{Dittmer.1966, year = {1966}, title = {Facsimile reproduction of the manuscript Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteo 29.1}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Brooklyn and New York}, volume = {X-XI}, series = {Publications of Mediaeval Manuscripts}, editor = {Dittmer, Luther} }Gillingham, Brian (Hrsg.), Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 14: Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin 1139, Ottawa 1987.
@book{Gillingham.1987, year = {1987}, title = {Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 14: Paris, Biblioth{\`e}que nationale, Fonds latin 1139}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Ottawa}, editor = {Gillingham, Brian} }——— (Hrsg.), Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 15: Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin 3719, Ottawa 1987.
@book{Gillingham.1987b, year = {1987}, title = {Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 15: Paris, Biblioth{\`e}que nationale, Fonds latin 3719}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Ottawa}, editor = {Gillingham, Brian} }——— (Hrsg.), Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 16: Paris, Bibliothèque nationale, Fonds latin 3549, and London British Library, Add. 36,881, Ottawa 1987.
@book{Gillingham.1987c, year = {1987}, title = {Publications of Mediaeval Musical Manuscripts, vol. 16: Paris, Biblioth{\`e}que nationale, Fonds latin 3549, and London British Library, Add. 36,881}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Ottawa}, editor = {Gillingham, Brian} }López-Calo S. J., José (Hrsg.), La Musica Medieval en Galicia, La Coruña 1982.
@book{LopezCaloS.J..1982, year = {1982}, title = {La Musica Medieval en Galicia}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {La Coru{\~n}a}, editor = {{L{\'o}pez-Calo S. J.}, Jos{\'e}} }Rankin, Susan (Hrsg.), The Winchester Troper. Facsimile Edition and Introduction (Early English Church), London 2007.
@book{Rankin.2007, year = {2007}, title = {The Winchester Troper. Facsimile Edition and Introduction}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {London}, volume = {50}, series = {Early English Church}, editor = {Rankin, Susan} }Roesner, Edward H. (Hrsg.), Antiphonarium seu magnus liber organi de gradali et antiphonario: Color microfiche edition of the manuscript Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1 (Codices illuminati Medii Aevi), München 1996.
@book{Roesner.1996, year = {1996}, title = {Antiphonarium seu magnus liber organi de gradali et antiphonario: Color microfiche edition of the manuscript Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {M{\"u}nchen}, volume = {45}, series = {Codices illuminati Medii Aevi}, editor = {Roesner, Edward H.} }Staehekin, Martin (Hrsg.), Die mittelalterliche Musik-Handschrift \frqqW1\flqq. Vollständige Reproduktion des Notre Dame-Manuskripts der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel Cod. Guelf. 628 Helmst. (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien), Wolfenbüttel 1995.
@book{Staehekin.1995, year = {1995}, title = {Die mittelalterliche Musik-Handschrift {\frqq}W1{\flqq}. Vollst{\"a}ndige Reproduktion des Notre Dame-Manuskripts der Herzog August Bibliothek Wolfenb{\"u}ttel Cod. Guelf. 628 Helmst.}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Wolfenb{\"u}ttel}, volume = {IX}, series = {Wolfenb{\"u}tteler Mittelalter-Studien}, editor = {Staehekin, Martin} }Thurston, Ethel (Hrsg.), The music in the St. Victor manuscript, Paris lat. 15139. Polyphony of the thirteenth century, Toronto 1959.
@book{Thurston.1959, year = {1959}, title = {The music in the St. Victor manuscript, Paris lat. 15139. Polyphony of the thirteenth century}, keywords = {Faksimilia;OrganumUndConductus}, address = {Toronto}, editor = {Thurston, Ethel} }
Literatur
Bachmann, Werner, „Die Verbreitung des Quintierens im europäischen Volksgesang des späten Mittelalters“ in: Walther Vetter (Hrsg.), Festschrift Max Schneider zum 80. Geburtstag , Leipzig 1955, S. 25–29.
@incollection{Bachmann.1955, author = {Bachmann, Werner}, title = {Die Verbreitung des Quintierens im europ{\"a}ischen Volksgesang des sp{\"a}ten Mittelalters}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {25--29}, editor = {Vetter, Walther}, booktitle = {Festschrift Max Schneider zum 80. Geburtstag}, year = {1955}, address = {Leipzig} }Bernagiewicz, Robert, „Die Musica Enchiriadis und die Aufführungspraxis des Gregorianischen Chorals“ in: BzG 54, 2012, S. 59–73.
@article{Bernagiewicz.2012, author = {Bernagiewicz, Robert}, year = {2012}, title = {Die Musica Enchiriadis und die Auff{\"u}hrungspraxis des Gregorianischen Chorals}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {59--73}, volume = {54}, journal = {BzG} }Danckwardt, Marianne, „Zur Notierung, klanglichen Anlage und Rhythmisierung der Mehrstimmigkeit in den Saint-Martial-Handschriften“ in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 68, 1984, S. 31–38.
@article{Danckwardt.1984, author = {Danckwardt, Marianne}, year = {1984}, title = {Zur Notierung, klanglichen Anlage und Rhythmisierung der Mehrstimmigkeit in den Saint-Martial-Handschriften}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {31--38}, volume = {68}, journal = {Kirchenmusikalisches Jahrbuch} }Reckow, Fritz, Die Copula. Über einige Zusammenhänge zwischen Setzweise, Formbildung, Rhythmus und Vortragsstil in der Mehrstimmigkeit von Notre Dame, Mainz 1972.
@book{DCUeZzSFRuVidMvNDReckow, author = {Reckow, Fritz}, year = {1972}, title = {Die Copula. {\"U}ber einige Zusammenh{\"a}nge zwischen Setzweise, Formbildung, Rhythmus und Vortragsstil in der Mehrstimmigkeit von Notre Dame}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Mainz} }Göllner, Theodor, Die mehrstimmigen liturgischen Lesungen, Tutzing 1969.
@book{DmlLGollner, author = {G{\"o}llner, Theodor}, year = {1969}, title = {Die mehrstimmigen liturgischen Lesungen}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Tutzing} }Geering, Arnold, Die Organa und mehrstimmigen Conductus in den Handschriften des deutschen Sprachgebietes vom 13. bis 16. Jahrhundert (Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft), Bern 1952.
@book{DOumCidHddSv1b1JGeering, author = {Geering, Arnold}, year = {1952}, title = {Die Organa und mehrstimmigen Conductus in den Handschriften des deutschen Sprachgebietes vom 13. bis 16. Jahrhundert}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Bern}, volume = {II/1}, series = {Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft} }Dyer, Jospeh, „A thirteenth century choirmaster. The Scientia Artis Musicae of Elias Salomon“ in: Musical Quaterly 66, 1980, S. 83–111.
@article{Dyer.1980, author = {Dyer, Jospeh}, year = {1980}, title = {A thirteenth century choirmaster. The Scientia Artis Musicae of Elias Salomon}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {83--111}, volume = {66}, journal = {Musical Quaterly} }Díaz y Díaz, Manuel, El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago: Estudio Codicológico y de contenido, Santiago de Compostela 1988.
@book{ECCdlCdSECydcDiazyDiaz, author = {{D{\'i}az y D{\'i}az}, Manuel}, year = {1988}, title = {El C{\'o}dice Calixtino de la Catedral de Santiago: Estudio Codicol{\'o}gico y de contenido}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Santiago de Compostela} }Ficker, Rudolf von, „Primäre Klangformen“ in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1929 , Leipzig 1930, S. 21–34.
@incollection{Ficker.1930, author = {von Ficker, Rudolf}, title = {Prim{\"a}re Klangformen}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {21--34}, booktitle = {Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1929}, year = {1930}, address = {Leipzig} }Fuller, Sarah Ann, Aquitanian Polyphony of the Eleventh and Twelfth Centuries, Diss., Berkeley, Ann Arbor 1970.
@phdthesis{Fuller.1970, author = {Fuller, Sarah Ann}, year = {1970}, title = {Aquitanian Polyphony of the Eleventh and Twelfth Centuries}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Ann Arbor}, school = {Berkeley}, type = {PhD Diss.} }———, „Hidden Polyphony. A Reappraisal“ in: Journal of the American Musicological Society 24, 1971, S. 169–192.
@article{Fuller.1971, author = {Fuller, Sarah Ann}, year = {1971}, title = {Hidden Polyphony. A Reappraisal}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {169--192}, volume = {24}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Husmann, Heinrich, „Das System der modalen Rhythmik“ in: Archiv für Musikwissenschaft 11, 1954, S. 1–38.
@article{Husmann.1954, author = {Husmann, Heinrich}, year = {1954}, title = {Das System der modalen Rhythmik}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {1--38}, volume = {11}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Krüger, Walther, „Zum Organum des Codex Calixtinus“ in: Die Musikforschung 17, 1964, S. 225–234.
@article{Kruger.1964, author = {Kr{\"u}ger, Walther}, year = {1964}, title = {Zum Organum des Codex Calixtinus}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {225--234}, volume = {17}, journal = {Die Musikforschung} }Rankin, Susan, „Winchester Polyphony. The early theory and practice of organum“ in: Susan Rankin und David Hiley (Hrsg.), usic in the Mediaeval English Liturgy , Oxford 1993, S. 59–99.
@incollection{Rankin.1993, author = {Rankin, Susan}, title = {Winchester Polyphony. The early theory and practice of organum}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {59--99}, editor = {Rankin, Susan and Hiley, David}, booktitle = {usic in the Mediaeval English Liturgy}, year = {1993}, address = {Oxford} }Ludwig, Friedrich, Repertorium organorum recentioris et Motetorum vetustissimi stili, Halle 1910.
@book{RoreMvsLudwig, author = {Ludwig, Friedrich}, year = {1910}, title = {Repertorium organorum recentioris et Motetorum vetustissimi stili}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Halle} }Apfel, Ernst, Sämtliche herausgegebenen musikalischen Satzlehren vom 12. bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts in deutschen Übersetzungen, Saarbrücken 1986.
@book{ShmSv1bgEd1JidUApfel, author = {Apfel, Ernst}, year = {1986}, title = {S{\"a}mtliche herausgegebenen musikalischen Satzlehren vom 12. bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts in deutschen {\"U}bersetzungen}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, address = {Saarbr{\"u}cken} }Tischler, Hans, „The evolution of the Magnus Liber Organi“ in: Musical Quaterly 70, 1984, S. 163–174.
@article{Tischler.1984, author = {Tischler, Hans}, year = {1984}, title = {The evolution of the Magnus Liber Organi}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {163--174}, volume = {70}, journal = {Musical Quaterly} }Varelli, Giovanni, „Two newly discovered tenth-century organa“ in: Early Music History 32, 2013, S. 277–315.
@article{Varelli.2013, author = {Varelli, Giovanni}, year = {2013}, title = {Two newly discovered tenth-century organa}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {277--315}, volume = {32}, journal = {Early Music History} }Yudkin, Jeremy, „The copula according to Johannes de Garlandia“ in: Musica disciplina 34, 1980, S. 67–84.
@article{Yudkin.1980, author = {Yudkin, Jeremy}, year = {1980}, title = {The copula according to Johannes de Garlandia}, keywords = {Literatur;OrganumUndConductus}, pages = {67--84}, volume = {34}, journal = {Musica disciplina} }
Motette
Wie bereits bei den Kyrie-Tropen zu beobachten, könnten einige clausulae auch umgekehrt für bereits bestehende Texte entworfen worden oder, wie z.B. in der Handschrift F-Pn lat. 15139 aus St. Victor, durch »Ent-Textierung« von Motetten entstanden sein. Dann wären die clausulae – zumindest einige – nur der strukturelle Rahmen für ein neues Formverhältnis zwischen dichterisch gestaltetem Text und Musik: Da wie bei den syllabischen Partien des Conductus bei einer syllabisch textierten Oberstimme einer Klausel der Rhythmus nicht mit Hilfe modaler Gruppen notiert werden konnte, bilden die Klauseln ohne Text mit modalrhythmischer Gruppennotation die rhythmische Ebene der frühen Motetten ab. Erst die graphische Ausdifferenzierung der Einzelzeichen in rhythmischer Bedeutung wird diese Doppelnotierung unnötig machen.
Bsp.: Ein Beispiel für die gegenseitige inhaltliche Verstärkung von Motetten- und Tenortext findet sich in einer im Codex Montpellier überlieferten dreistimmigen Motette (F-MOf H 196 <https://manuscrits.scdi-montpellier.fr/vignettem.php?GENRE[]=MP&ETG=OR&ETT=OR&ETM=OR&BASE=manuf>, f. 100v–101r) stammt hierbei aus dem Alleluia-Vers Nativitas gloriose virginis Marie ex semine Abrahe orta de tribu Juda clara ex stirpe David und wird von den beiden Oberstimmen tropierend aufgegriffen, die zudem beide theologisch ausdeutend mit sine semine schließen.
Weitere Texte konnten die zweistimmigen Motetten mit einem textierten Triplum oder Quadruplum zur drei- oder vierstimmigen Motette erweitern. Aus dreistimmigen Conductus mit nur einem gemeinsamen Text und einem Tenor ergaben sich vierstimmige Conductus-Motetten, wie bei Latex silice und Serena virginum in Codex F (f. 230v–231v; 235–237v).
Die Motette El mois d'avril/O quam sancta/Et gaudebit im Codex Montpellier (f. 63v–64r) ist Teil eines großen Komplexes von Motetten über dem Tenor Et gaudebit aus dem Vers Non vos relinquam des Alleluias an Christi Himmelfahrt. Den Ausgangspunkt bildet eine zweistimmige Klausel in F (f. 161v-162) bzw. St. Victor (F-Pn lat. 15139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139>, f. 289v-290r).
Darauf aufbauend sind insgesamt 10 Motetten in verschiedenen Handschriften überliefert, die die ganze Bandbreite der Gattung Motette umfassen: Eine zweistimmige Motette mit lateinisch textiertem Duplum (drei Versionen), eine dreistimmige Conductus-Motette mit lateinischem Text, eine dreistimmige Motette mit zwei lateinischen Texten (zwei Versionen) oder zwei französischen Texten, die genannte dreistimmige Motette mit französischem Triplum, sowie eine vierstimmige Motette mit französischem Quadruplum und lateinischem Triplum und Duplum. Das Triplum El mois d'avril enthält außerdem die beiden Refrains Aimi! Ja ne m'en partirai car loial l'ai l'ami und Amors noveles font fins amans jolis.
Die in den Motetten zitierten Refrains oder Zusammenstellungen von Refrains stammen aus verlorenen Tanzliedern oder aus einstimmigen Chansons zeitgenössischer Trouvères. Sie können als ganze Strophe im Motetus erscheinen oder als Zitate zu Beginn, in der Mitte oder am Schluss, oder in zwei Hälften die Motette zu Beginn und Schluss in Gestalt eines sogenannten motet enté umrahmen, wie z.B. in Adam de la Halles Motette Aucun se sont loé d´amours/A dieu commant amouretes/Super te (F-Pn f. fr. 25566, f. 34v–35r), mit einem seiner eigenen Rondeaus als Refrain im Motetus.
Vielschichtige Beziehungen bestehen zwischen Motetten mit verschiedener Stimmenzahl, verschiedenen und verschiedensprachigen Texten über demselben Tenor und weltlicher Liebeslyrik. Einige Motetten mit Refrains bilden Zyklen aus, indem sie fortlaufende Ausschnitte aus demselben cantus als Tenores verwenden, etwa die Tenor-Folge Alleluya, Hodie, Gaudete aus dem All. Hodie Maria virgo celos ascendit gaudete quia cum Christo regnat.
E-BUlh 9 <https://botiga.bnc.cat/?product=el-codex-musical-de-las-huelgas-musica-a-veus-dels-segles-xiii-xiv-volum-ii-facsimil> (Codex Las Huelgas, Monasterio de Santa Maria Real de las Huelgas) wurde gegen Ende des ersten Viertels des 14. Jahrhunderts kompiliert und enthält 45 einstimmige und 141 mehrstimmige Gesänge, die stilistisch von zweistimmigen Organa aquitanischer Tradition, über Organa im Stil der Notre Dame-Schule, Motetten und Conductus der Ars antiqua bis zu Kompositionen im Stil der beginnenden Ars nova in Modal- bis Franconischer Mensuralnotation reichen. Die Pergamenthandschrift, die deutliche Gebrauchsspuren zeigt, dürfte mit tropierten Ordinariumssätzen, Sequenzen, Hymnen und Conductus das Repertoire für die feierliche Gestaltung der Liturgie des Konvents darstellen. Der Codex wurde vermutlich in Toledo, aber für Las Huelgas, geschrieben und hat zahlreiche Korrekturen und Vervollständigungen, u.a. von dem Schreiber Johan Rodrigues, erfahren. Es handelt sich bei diesem Repertoire um mehrstimmige Gesänge für Messe und Offizium sowie für paraliturgische Anlässe, die zum größten Teil Konkordanzen in den Hauptquellen der Notre Dame-Schule sowie in den Codices von Bamberg und Montpellier besitzen. Dieser besondere Schwerpunkt auf mehrstimmiger Ausgestaltung der Liturgie, der in auffälligem Kontrast zur generell ablehnenden Haltung des Zisterzienserordens gegenüber jeglicher Art von Schmuck auch im Musikalischen steht, mag mit der Sonderrolle zusammenhängen, die die zisterziensischen Frauenkonvente im 13. Jahrhundert einnahmen. Der Orden zeigte sich äußerst reserviert gegenüber Frauengemeinschaften und verbot in den Generalkapiteln von 1220 und 1228 sogar neue Frauenklöster, erlaubte jedoch die Annahme der Zisterzienser-Regel für Frauenkonvente, die nicht direkt dem Orden inkorporiert waren, wenn damit keine seelsorgerlichen Verpflichtungen männlicher Ordensangehöriger verbunden waren. Dort galten somit nicht die gleich strengen Regeln wie in den Männerklöstern und dies bot den Zisterzienserinnenklöstern offenbar mehr Freiraum zur Erweiterung und Ausschmückung der Liturgie. Das Kloster Las Huelgas wurde 1187 als königliche Stiftung von Eleonore von Kastilien und ihrem Mann König Alfonso VIII. gegründet, die damit dem Vorbild ihrer Mutter Eleonore von Aquitanien und deren Stiftung Fontevrault folgte, ebenso wie später Blanche von Kastilien , die Tochter Eleonores von Kastilien, mit ihrer Stiftung des Zisterzienserinnenklosters Maubuisson . 1199 wurde Las Huelgas schließlich doch in den Orden aufgenommen wurde, genoss es doch als Grablege der königlichen Familie umfangreiche Privilegien und war die Äbtissin mit außerordentlichen Machtbefugnissen ausgestattet. Konstanze und Berenguela von Kastilien, beide Angehörige der Königsfamilie, agieren im 13. Jahrhundert in Las Huelgas in der Funktion von Äbtissinnen. Es ist zumindest anzunehmen, dass Teile des Repertoires aus dem Codex Las Huelgas auch von den dortigen Nonnen im 13. Jahrhundert gesungen wurden. Eine zweistimmige Gesangsübung auf f. 154v der Handschrift fordert die Nonnen zum mehrstimmigen Gesang auf (organizare curate), und ein Beleg aus dem späten 13. Jahrhundert spricht vom dreistimmigen Gesang der Nonnen am ersten Sonntag im Advent (cantan en tres bozes). Für das 13. Jahrhundert sind in Las Huelgas die Nonnen Sancha García, Inés González, Marina Guillén und Urraca García jeweils als cantora urkundlich belegt, die solche mehrstimmigen Gesänge gepflegt haben könnte. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass die in Las Huelgas zur seelsorgerischen Betreuung anwesenden Geistlichen dieses Gesangsrepertoire aufgeführt haben. Dennoch können auch die Nonnen, zumal eines Klosters mit solcher Reputation und einer solchen Sonderstellung wie Las Huelgas, in der musikalischen Ausgestaltung der Liturgie Besonderes geleistet und sich dabei der mehrstimmigen Kunst des 13. Jahrhunderts bedient haben.
Codex Montpellier könnte um 1270 im Umfeld von König Philipp III. (»der Kühne«) von Frankreich (1245–1285) und seiner Frau Marie von Brabant (1254–1321) entstanden sein, deren Vater Heinrich III. von Brabant ein großer Förderer der Trouvères war und selbst als solcher hervortrat. Der Codex gliedert seinen Inhalt in seinem ursprünglichen Aufbau der Faszikel 2–6 in vierstimmige Motetten (Faszikel 2, beginnend mit der Motette Qui la vaudroit lonctans/Qui damors velt bien ioir/Qui longuement/Nostrum , f. 23v–24r), gefolgt von dreistimmigen Motetten mit zwei verschiedensprachigen Texten in Latein und Französisch (Faszikel 3, beginnend mit El mois d'avril/O quam sancta/Et gaudebit, f. 64v–64r), dreistimmigen lateinischen Motetten (Faszikel 4, beginnend mit Conditio nature defuit/O natio nephandi/[Mane prima sabbati] , f. 87v–88r), dreistimmigen französischen Motetten (Faszikel 5, beginnend mit Lautrier mesbatoie/Demenant grant ioie/Manere , f. 111v–112r) und zweistimmigen französischen Motetten (Faszikel 6, beginnend mit Ne ma pas oublie/In seculum , f. 246r). Ordnungskriterien sind also die Stimmenzahl und die verwendeten Sprachen. Faszikel 1 und 7 stammen vom Ende des 13. Jahrhunderts, Faszikel 8 aus dem frühen 14. Jahrhundert, notiert im voll ausgebauten System der Franconischen Mensuralnotation.
Die aus dem späten 13. Jahrhundert stammende Handschrift F-Pn n.a. 13521 (Manuscrit de La Clayette), die u.a. eine Sammlung Motetten enthält, und teilweise Codex Montpellier verwenden zwar das neue Motetten-Layout, schreiben die Stimmen aber fortlaufend mit dem Tenor am Ende. Codex Bamberg und Las Huelgas entwickeln dieses Layout im Sinne einer besseren Struktursichtigkeit weiter, indem sie links das Triplum, rechts den Motetus und unter beiden Spalten quer verlaufend den ganzen Tenor als verbindendes Fundament platzieren, so dass die Stimmen auch für den gemeinsamen Vortrag besser koordiniert sind.
Nach den Regeln von Franco von Köln zur Mensuralnotation gehört eine einzelne Brevis zu einer Perfectio-Einheit und kann daher eine vorausgehende (a parte post ) oder eine nachfolgende Longa (a parte ante ) imperfizieren:
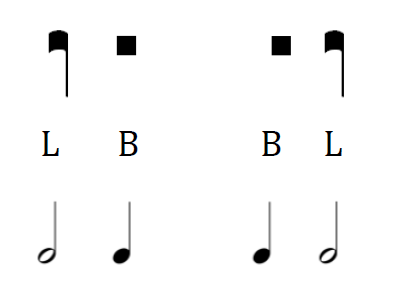
Stehen zwei Breven zwischen zwei Longen, bilden beide Breven eine Perfectio, indem die zweite alteriert wird. Diese alterierte Brevis kann hierbei nicht als Longa geschrieben werden, da sie sonst der Grundregel gemäß vor einer nachfolgenden Longa dreizeitig sein müsste (similis ante similem perfecta):
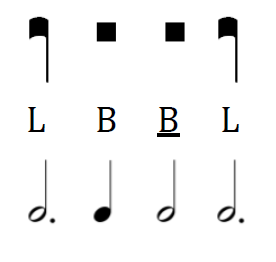
Drei Breven zwischen Longen bilden eine eigene Perfectio:
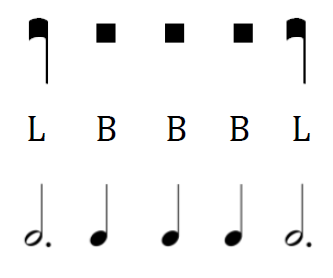
Dieselben Regeln gelten auf der Ebene Brevis zu Semibrevis.
Der punctus divisionis dient zur Gruppierung und Durchbrechung von Regeln, etwa wenn er zwischen den zwei Breven zwischen zwei Longen steht und damit entgegen der Alterationsregel eine Imperfizierung der ersten Longa (a parte post) durch die erste Brevis und der zweiten Longa (a parte ante) durch die zweite Brevis auslöst:
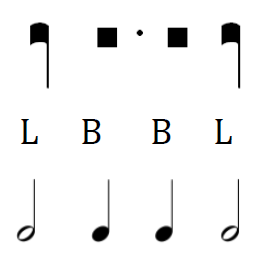
Die Pausen bezeichnet Franco mit einem Strich in einem Notelinien-Zwischenraum für die Brevis, einem halben (von oben) für die Semibrevis, zwei Zwischenräumen für die imperfekte Longa oder die alterierte Brevis, drei Zwischenräumen für die perfekte Longa und einem Doppelstrich über jeweils drei Zwischenräume für die Duplex Longa oder Maxima.
Für die Ligaturen nimmt Franco die zweitönigen Neumenformen der Quadratnotation als Ausgangspunkt: die absteigende Form der Clivis mit dem Anstrich auf der linken Seite und den aufsteigenden Pes ohne Strich. Beide Formen bedeuten von der Modalnotation her kommend die Folge Brevis-Longa und weisen zu Beginn die Eigenschaft cum proprietate und am Ende cum perfectione auf. Die proprietas der ersten Note kann durch Weglassen des Anstrichs bei der absteigenden oder Hinzufügung eines Longastrichs auf der rechten Seite bei der aufsteigenden Form verändert werden, womit sie zur Longa wird. Ein Strich zu Beginn nach oben führt zur Form cum opposita proprietate , bei der beide Noten zu Semibreven werden. Die perfectio der zweiten/letzten Note wird durch ihre Drehung nach rechts bei der aufsteigenden oder durch oblique Schreibweise bei der absteigenden Form verändert, womit sie zur Brevis wird.
Hieraus ergeben sich jeweils fünf verschiedene graphische Formen für die beiden zweitönigen Ausgangsligaturen, entsprechend den Notenwert-Folgen:
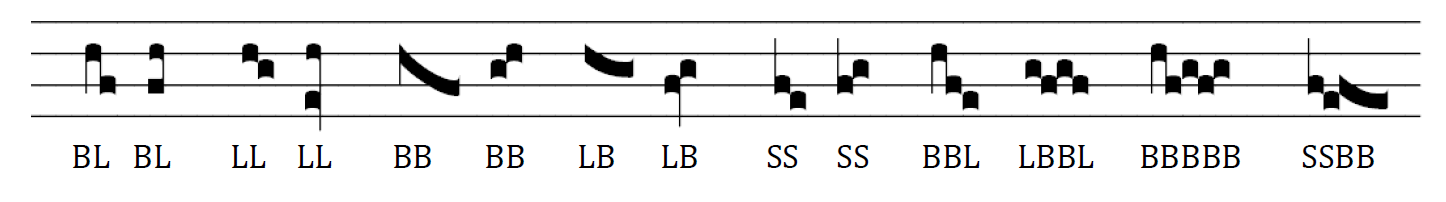
B-L (cum proprietate, cum perfectione)
L-L (sine proprietate, cum perfectione)
B-B (cum proprietate, sine perfectione)
L-B (sine proprietate, sine perfectione)
S-S (cum opposita proprietate)
Bei mehrtönigen Ligaturen sind alle Noten zwischen der ersten und der letzten Breven, außer bei der Ligatur cum opposita proprietate, bei der immer die beiden ersten Noten Semibreven sind, oder durch Hinzufügung eines Longastrichs innerhalb der inneren Breven. Bereits Anonymus 4 erwähnt Franco von Köln und seine neuartige Notationsweise, was auf die intimen Verbindungen Francos nach Paris und mit der von dort ausgehenden kompositorischen Avantgarde hinweist. Codex Montpellier H 196 zeigt in seinem 7. und 8. Faszikel die Verwendung des Franconischen Notationssystems.
Die Unterteilung der Brevis in mehr als die bisher möglichen drei kleineren Werte und damit die Teilung der Semibrevis in kleinere Werte findet sich im 7. Faszikel von Codex Montpellier, beginnend mit Petrus de Cruces Motette S´amours eust point de poer/Au renouveler du ioli tans/Ecce iam votiva (f. 270r–273r. Petrus de Cruce wirkte zwischen 1260 und 1290 in Paris und später in Amiens als Lehrer.
Bsp.: Ein berühmtes Beispiel ist die ihm zugeschriebene Motette Aucunt ont trouve chant par usage/Lonc tans me sui tenu de chanter/Annuntiantes (f. 273-274v), Edition Tischler 1978, Bd. 3, S. 65–67), die von mehreren zeitgenössischen Autoren erwähnt wird: Das Triplum beginnt mit Folgen von zwei (»Au-cun«), drei (»ont trou-ve«), drei (»chant par u-«), zwei (»-sa-ge«) und fünf (»mes a moi en doune«) Semibreven, jeweils durch einen Punkt zur Gruppierung getrennt. Auf f. 273v finden sich sogar Gruppen von sechs (»res-bau-dist mon cou-ra-«) und sieben (»li ai fait hou-ma-ge pour«) Semibreven. Stilistisch verstärkt sich die Differenzierung zwischen schnell bewegtem und deklamierendem Triplum, langsamerem Duplum und den relativ langen Tönen des Tenors in Longen, was eine gewisse Verlangsamung des Tempos zur Wahrung der Verständlichkeit nach sich ziehen musste. Die schnellere Deklamation des Triplums ermöglicht es jedenfalls, dass seine 25 Verse in der gleichen Zeit wie die nur 11 Verse des Motetus vorgetragen werden können. Die kompositorische Innovation verschiebt also die Notwendigkeit zur genauen zeitlichen Bestimmung, nachdem diese für Longa, Brevis und Semibrevis geleistet war, an den oberen Rand des Systems. Denn wie genau die verschiedene Zahl von Semibreven innerhalb des Zeitwertes einer Brevis aufgeteilt werden sollten, war nicht klar, zumal es graphisch keinen Unterschied zwischen dem Semibrevis-Zeichen und den die Semibrevis unterteilenden neuen kleineren Werte gab.
Als Erbe der aus der Motettennotation bekannten Schreibweise kleinerer Notenwerte als aufwärtsgehende Plica und der daraus entstehenden Konvention des auf der linken Seite nach oben gehenden Striches als Repräsentant zweier Semibreven, die in den Ligaturregeln als cum opposita proprietate bezeichnet wird, entsteht die Minima (zunächst: semibrevis minima) graphisch aus der Semibrevis durch den opposita-Strich nach oben.
Bsp.: In der Traktatgruppe, die unter dem Sammelnamen Ars nova als Notationslehre Philippe de Vitry zugeschrieben wurde, wird am Beispiel des Tenors der Philippe de Vitry zugeschriebenen Motette Garrit gallus/In nova fert [Tenor] aus der Roman de Fauvel-Handschrift (F-Pn f. fr. 146 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f104.item>, f. 44v) die Praxis der Kolorierung erläutert:
Der color des nichtidentifizierten Tenors besteht im modus perfectus, tempus imperfectum cum prolatione maiori aus drei taleae, jeweils mit der Folge der vier Dreier-Ligaturen
LBB BBL (L) LBB BBL (L)
Die rot geschriebenen Noten verringern dabei die Longawerte um 1/3 und lassen zweizeitige Longen entstehen, so dass hier Alterationen oder Imperfizierungen keine Anwendung finden (die Klammern zeigen Pausen an, Unterstreichungen die durch Alteration entstehende zweiwertige Brevis). Der nach der Longapause folgende Abschnitt erscheint als Rücklauf des ihr vorhergehenden (ausgenommen die letzte Longa-Pause). Obwohl in der Handschrift nicht angezeigt, muss der Tenor bei der Ausführung der Motette einmal wiederholt werden, wobei die Oberstimmen die komplexe Strukturierung des Tenors unterstützen. Inhaltlich trägt die Motette in raffinierten Anspielungen beißende Kritik am französischen König Philipp IV. (1268–1314, im Triplum als leo = (blinder) Löwe bezeichnet) und seinem Schatzmeister Enguerrand de Marigny (im Triplum als vulpus = (verräterischer) Fuchs, mit dem auch zugleich Fauvel gemeint ist, bezeichnet), der die französische Nation (im Triplum als gallus = Hahn bezeichnet) betrügt, vor. Das Duplum beginnt mit dem Zitat »In nova fert animus mutatas dicere formas« aus Ovids Metamorphosen und spielt damit auf die verkehrte Welt und die Ungeheuerlichkeiten im Bereich von Hof und Kirche, etwa auf die unter Philipp IV. eingeleitete »babyonische Gefangenschaft« der Kirche in Avignon, an.
In Philippe de Vitrys Motette Tribum que non abhorruit/Quoniam secta/Merito hec patimur (F-Pn f. fr. 146 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f104.item>. 41v–42r), zu der inhaltlich auch die Motette Aman novi/Heu Fortuna/Heu me (f. 30r) gehört, wird ebenfalls mit einem Ovid-Zitat am Ende des Duplums Genugtuung über den Tod von Enguerrand de Marigny geäußert: Er wurde am 30. April 1315 in Montfaucon öffentlich gehängt.
Die Fauvel-Handschrift bildet insgesamt eine von Chaillou de Pesstain zusammen mit einem Kreis von Dichtern und Musikern im Umfeld des französischen Hofes um 1320 erweiterte Fassung der satirischen Dichtung von Gervès du Bu (um 1310) über den falben Esel FAUVEL (zusammengesetzt aus den Lastern F = Flatterie, A = Avarice, U/V = Vilainie, V = Variété, E = Envie, L = Lâcheté) und dessen Aufstieg und Fall in Abhängigkeit vom Rad der Dame Fortune. Den politischen Hintergrund bilden die Intrigen während der Regierungszeit von König Philipp IV. und seiner beiden Söhne König Ludwig X. und König Philipp V. sowie seines Bruders Karl von Valois .
In einer Art multimedialem Gesamtkunstwerk wurden neben vielen kunstvollen Illuminationen auch um die 169 liturgische Gesänge und Kompositionen, die den verschiedensten Stilen und Gattungen entstammen und teilweise neu bearbeitet wurden, interpoliert. Darunter befinden sich 34 Motetten (eine vierstimmig, 23 dreistimmig, 10 zweistimmig, darunter auch einige Philippe de Vitry zugeschriebene Motetten), aber auch einstimmige lateinische Responsorien, Antiphonen, Alleluias, Hymnen, Sequenzen und französische Refrains (moteiz, lais, proses, balades, rondeaux, respons, antenes et versez). Es handelt sich damit um das früheste Zeugnis der französischen Ars Nova.
Durch die Kolorierung der Minima wird die Semiminima gewonnen, eine einzelne kolorierte Brevis bietet im Kontext einer vorangehenden Semibrevis eine Alternative zur Alterierung . Durch Gruppen-Kolorierung werden die alternativen Gliederungen von Sechsereinheiten in 2 x 3 und 3 x 2 und damit der Wechsel zwischen den Mensuren tempus perfectum cum prolatione minori und tempus imperfectum cum prolatione maiori ausgedrückt.
Der mathematisch-rationalen Durchdringung der musikalischen Zeit, die sich in der Notre Dame-Schule ankündigt und in den vier prolationes der Ars nova fortsetzt, entsprechen die ersten großen, öffentlichen astronomischen Uhren, die im 14. Jahrhundert z.B. in Straßburg, Padua, Salisbury und Rouen installiert werden.
Klanglich tritt als Signum des 14. Jahrhunderts besonders die Markierung der Kadenzen durch die Doppel-Leittonkadenz hervor. Sie entsteht aus der bereits in der Mehrstimmigkeitspraxis seit dem 12. Jahrhundert aufgestellten Forderung nach dem Qualitätswechsel vom imperfekten Penultima-Klang zum perfekten Schlussklang und der sich gegenseitig verstärkenden Kombination des Sext-Oktav-Schrittes und des Terz-Quint-Schrittes. Die hierbei unter Umständen notwendigen Erhöhungen der Leittöne, die im nur die bewegliche Stufe H/B enthaltenden Tonsystem nicht vorgesehen sind, werden von den Theoretikern unter dem Begriff der musica falsa oder ficta besprochen. In den Handschriften sind diese erhöhten Stufen meistens nicht oder nur selten und inkonsequent markiert, da deren Gebrauch offenbar weitgehend der praktischen Aufführung und den Kenntnissen der Sänger überlassen wurde. Ihre Anwendung ist deshalb auch heute ein typisches Beispiel für den Zwischenbereich von wissenschaftlicher Forschung und praxisbezogenem Experimentieren.
Bsp.: Zu Beginn von Guillaume de Machauts Ballade Biauté que toutes autres peres (F-Pn f. fr. 9221 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k>, f. 152v-153) ist in der Handschrift im Cantus am Anfang von Mensur 3 die Semibrevis g durch Kreuzzeichen zum gis erhöht. Dies zieht nach sich, dass auch bei den folgenden vier Minimen nicht nur g zu gis, sondern auch f zu fis erhöht werden soll, um die leittönige Verbindung gis-a mit einem Ganzton von fis aus zu erreichen. Die von Mensur 3 auf 4 eintretende Doppelleittonkadenz verlangt die Erhöhung der Brevis c im Contratenor zu cis. Die Brevis fis im Tenor am Ende von Mensur 5 impliziert wiederum ziemlich sicher eine Semibrevis fis im Cantus zu Beginn derselben Mensur, ebenso die Minima b im Cantus am Ende von Mensur 7 entsprechende b-Vorzeichen in Contratenor und Tenor in derselben Mensur.
In einzelnen Kompositionen der Ars subtilior, wie dem berühmten Fumeux fume par fumee von Solage (F-CH 564, f. 59) sind so viele ficta explizit bzw. implizit gefordert, dass das ganze Stück als typisches Zeichen des Austestens aller musikalischen und notationstechnischen Grenzen dieser Epoche ständig die Tonalität verschleiert, was dem durch das Rauchen erzeugten Qualm, von dem im Text die Rede ist, durchaus entsprechen könnte.
Die Notationspraxis in Italien unterscheidet sich insofern von der französischen, als sie die Brevis auf drei Ebenen unterteilt. Wie Marchetto da Padua (1274? – um 1319) in seinem Pomerium in arte musicae mensuratae (um 1319 am Hof von Robert von Anjou in Neapel) ausführt, besteht hierbei
die erste Ebene (divisio prima)
aus der Teilung der Brevis in 2 (binaria) oder 3 (ternaria*) Semibreves,
die zweite Ebene (divisio secunda)
aus der Teilung der 2 Semibreven der binaria in
jeweils 2 (quaternaria = 2 x 2 = 4) oder jeweils 3 (senaria imperfecta = 2 x 3 = 6) Semibreves,
oder der Teilung der 3 Semibreven der ternaria
in jeweils 2 (senaria perfecta = 3 x 2 = 6) oder 3 (novenaria = 3 x 3 = 9) Semibreves
und die dritte Ebene (divisio tertia)
aus der der Teilung der 2 Semibreven der binaria in
jeweils 4 (octonaria = 2 x 4 = 8) Semibreves
oder der Teilung der 3 Semibreven der ternaria in
jeweils 4 (duodenaria = 3 x 4 = 12) Semibreves.
Auf der Ebene der divisio secunda und tertia werden hierbei die Semibreven mit einem Hals geschrieben und entsprechen damit der Minima. Um die verschiedenen Unterteilungen der Semibreven deutlich zu machen, wurden die Gruppen jeweils links und rechts mit einem Punkt, vergleichbar dem punctus divisionis, versehen und auch zu Beginn der Kompositionen mit den Kürzeln ».q.« (quaternaria), ».i.« (senaria imperfecta), ».p.« (senaria perfecta), ».n.« (novenaria), ».o.« (octonaria) und ».d.« (duodenaria) angegeben.
Kleinere Notenwerte unterhalb der semibrevis minima werden mit einer Schlaufe oder einem Fähnchen nach rechts als semibrevis semiminima markiert:

Gruppen von drei Semiminimen mit Fähnchen nach links füllen zwei Minimen aus, also in triolischer Funktion:
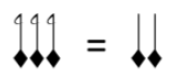
Eine Semibrevis mit mit einem zusätzlichen schrägen Strich nach links unten zeigt den Wert von drei Semiminimen, also eine punktierte Minima an:

Darüber hinaus erlaubt das System flexible Variationen: Wenn in einer divisio nicht alle Notenwerte vorhanden sind, kann dies durch lange Noten am Ende einer Gruppe (via naturae ) oder längere Notenwerte zu Beginn oder in der Mitte einer Gruppe, die durch eine veränderte graphische Gestalt der Semibrevis, normalerweise einem Strich unter der Note, angezeigt werden (% subject via artis %}), ausgeglichen werden.

Die feineren Unterteilungsmöglichkeiten der italienischen Notation kommen vor allem den virtuos kolorierten Oberstimmen der Musik des Trecento entgegen bzw. sind durch sie motiviert. Dies trifft auch für die häufige Verwendung des Sechslinien-Systems zu, woran italienische Handschriften leicht zu erkennen sind. Im Laufe des 14. Jahrhunderts gelangt die italienische Notation dann zunehmend unter den Einfluss der französischen.
Das Motettenschaffen im Italien des 14. Jahrhunderts ist im Gegensatz zu Frankreich nur fragmentarisch überliefert und noch nicht besonders gut erforscht. Einer einfachen Verklanglichungspraxis mit Oktav- und Einklangsparallelen entstammen die ältesten italienischen Motetten, die wie etwa Ortorum virentium/Virga Yesse/[Victime paschali] oder Dulcis Ihesu memoria/[Iesu nostra redemptio]/[Tenor] in der Laude-Handschrift I-Fn, Banco Rari 18 (f. 146v–148r, 148v–149v) enthalten sind.
Johannes Ciconias Motetten sind u.a. den beiden illegitimen Söhnen des Herrn von Padua, Francesco il Novello da Carrara gewidmet: O felix templum iubila Bischof Stefano Carrara von Padua (reg. 1402–1405) und Padu […] serenans/Pastor bonus Andrea Carrara, Abt von Santa Giustina (reg. 1402–1404). In O Padua sidus preclarum , O felix templum iubila, Albane misse celitus/Albane doctor maxime und Venecie mundi splendor/Michael qui Steno domus nennt sich Ciconia selbst beim Namen. Typisch sind die imitatorische Struktur der Stimmen sowie weitausschwingende Melismen mit Hoketus-Passagen in der Tradition des 14. Jahrhunderts über dem Schluss-Amen. Ciconias zweistimmige Komposition O Petre Christi discipule ist vermutlich für die Erhebung des Venezianers Pietro Emiliani zum Bischof von Vicenza (1409) entstanden, vielleicht aber auch für die Krönung von Pietro Philargi/Filargo zu Papst Alexander V. auf dem Konzil von Pisa 1409 oder für Pietro Marcello, Bischof von Padua (1409–1428). Von der weiten Verbreitung von Ciconias Musik zeugen die Intavolierungen seiner Werke, so etwa seiner Ballata Con lagreme bagnandome il viso auf einen Text von Leonardo Giustiniani zur Hinrichtung von Francesco il Novello da Carrara 1406 oder auf den Tod von dessen Vater Francesco il Vecchio da Carrara 1393 im Buxheimer Orgelbuch (D-Mbs Mus. Ms. 3725 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0004/bsb00045513/images/>, Nr. 38, 137, 138, 139) und im Lochamer Liederbuch (D-B Mus. Ms. 40613 <http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN645230707&PHYSID=PHYS_0001>, p. 86-87).
Die lateinische Motette dient besonders im 14. Jahrhundert am päpstlichen Hof von Avignon politischen Zielen und Inhalten, die auf die »Staatsmotette« des 15. Jahrhunderts vorausweisen. So ist Philippe de Vitrys Motette Petre Clemens/Lugentium siccentur/[Tenor] anlässlich des Besuchs einer römischen Gesandtschaft am Hof Papst Clemens VI. entstanden. Die anonyme Motette Pictagore per dogmata/O terra sancta/Rosa vernans wurde zwischen 1374 und 1376 für Papst Gregor XI. , den Nachfolger und Neffen Clemens VI., geschrieben.
Die Vertreter der Ars subtilior waren an den Hofhaltungen der Gegenpäpste Alexander V. (Gegenpapst) (Pietro Philargi/Filargo) und Johannes XXIII. (Gegenpapst) (Baldassare Cossa) zwischen Rom, Florenz, Bologna und Konstanz tätig und hatten auch Verbindungen zum Hof von Neapel und Aragon und zu Herzog Jean de Berry in Chantilly. Als weiterer Mäzen wirkte Gaston »Fébus« III. , Graf von Foix (1331–1391) mit seiner glanzvollen Hofhaltung, die besondere musikalische »Delikatessen« einschloss, wie der Chronist Jean Froissart (1337 bis um 1405) anlässlich eines Aufenthalts dort 1388 berichtet. Für die Hofhaltung von Gian Galeazzo Visconti (1351–1402) in Pavia sind vermutlich Ciconias Kanon Le ray au soleyl und sein Virelais Sus une fontayne , das Philippus da Caserta zitiert, sowie sein Madrigal Una panthera in compagnia di Marte , das allerdings den einfacheren typisch norditalienischen Stil zeigt, entstanden.
Die Notation der Ars subtilior führt neue Notenformen ein:
Vierergruppen von hohlen roten Minimen nehmen die Zeit von 3 normalen Minimen einer perefekten Semibrevis ein:
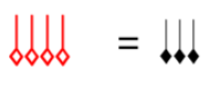
3 hohle rote Minimen mit Fähnchen unten und Hals oben nehmen die Zeit von 2 hohlen roten Minimen ein:
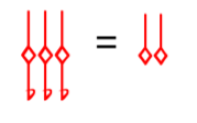
3 weiße hohle Minimen mit Fähnchen oben und Hals unten nehmen wiederum die Zeit von 2 hohlen roten Minimen mit Fähnchen unten und Hals oben ein.
Baude Cordier fügt in seinem in Herzform notierten Rondeau Belle bonne sage (F-CH Chantilly, Musée Condé MS 564, f. 11v) als weitere Komplexität gegen Ende der Cantus-Stimme die Proportionsangabe 8:9 hinzu: 8 der folgenden Notenwerte sollen die Zeit von 9 der vorausgehenden einnehmen.
Der Codex Chantilly (F-CH MS 564 <https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=15953>) wurde wahrscheinlich im frühen 15. Jahrhundert in Italien zusammengestellt und enthält 96 Chansons und 10 Motetten, die zwischen 1380 und 1390 datiert werden. Die beiden den Kodex eröffnenden Kompositionen von Baude Cordier (Belle bonne sage und Tout par compas) wurden der Handschrift allerdings erst im 2. Viertel des 15. Jh. wahrscheinlich von seinem späteren Florentiner Besitzer hinzugefügt.
Obwohl diese Musik trotz ihrer Komplexität nicht konstruiert klingt, mangelt es nicht an zeitgenössischer Kritik. In der Ballade Or voit tout en aventure (Codex Chantilly, f. 25v) beklagt der Komponist Guido, dass das klassische Vorbild von Philippe de Vitry verlassen wurde: Philipe qui mais ne dure/Nos dona boin exemplaire/Nos laisons tous ses afayres. Ganz so wie bereits zuvor Johannes XXII. die grenzenlose Lust am Vermessen der musikalischen Zeit bei den Vertetern der Ars nova anprangerte, so klagt Guidos Balladentext nun die Entwicklungen der Ars subtilior, mit Marchetto da Padova als ihrem Wegbereiter, der »Maßlosigkeit« an: L’art de Marquet n’a mesure.
Als weitere Quelle zur Überlieferung der Ars subtilior ist die Handschrift I-Tn J. II. 9 zu nennen, die zwischen 1413 und 1434 im Zusammenhang mit der Monarchie der Lusignan auf Zypern entstand und in fünf großen Teilen einstimmige Gesänge für Messe und Offizium (sechs einstimmige Messzyklen und zwei Reimoffizien), 17 drei- bzw. vierstimmige Messesätze, 33 lateinische und 8 französische Motettten in der Regel zu vier Stimmen sowie 102 Balladen, 43 Rondeaux und 21 Virelais meist für drei Stimmen enthält.
Die 1871 in Strassburg verbrannte Handschrift F-Sm (Strasbourg, Bibliothèque municipale) 222 C. 22 wurde zwischen 1411 (musiktheoretischer Traktat am Ende der Handschrift) und 1440 kompiliert und könnte das musikalische Repertoire zur Zeit des Konstanzer Konzils mit Ordinariumssätzen, Motetten, französischen Chansons und einigen deutschen und lateinischen Liedern widerspiegeln.
Die vier einstimmigen (Los set gotx , Cuncti sumus concanentes , Polorum regina , Ad mortem festinamus ), zwei zweistimmigen (Stella splendens , Inperayritz della ciutat ioyosa ) und vier dreistimmigen Gesänge (die »Caça« O virgo splendens , Laudemus virginem , Splendens ceptigera , Mariam matrem virginem in Latein und Katalanisch des Llibre Vermell weisen eine einfachere Art der Mehrstimmigkeit in Kanons und in Virelai-Form auf.
Quellen
Motette El mois d'avril/O quam sancta/Et gaudebit: F-MOf H 196, f. 63v–64r
Initiale zu Beginn des Triplum:
Initiale zu Beginn des Duplum:
Jakob Senleches: Virelais La harpe de mélodie: US-Cn (Chicago, Newberry Library) Ms. 54.1, f. 10r
Guillaume de Machaut: Motette O livoris feritas/Fons tocius superbie/Fera pessima (F-Pn fr. 1584, f. 422v-423r
Marchetto da Padova: Motette Ave regina celorum/Mater innocentie/Ite Joseph: GB-Ob Ms. Canon. Class. Lat. 112, f. 61v-62v
Motette Campanis cum cymbalis/Onoremus dominam: GB-Ob Mus. c. 60, f. 85v
Quellentexte und Editionen
Andreson, Gordon (Hrsg.), Compositions of the Bamberg manuscript: Bamberg, Staatsbibliothek, lit. 115 (olim Ed. IV.6) (CMM), Neuhause-Stuttgart 1977.
@book{Andreson.1977, year = {1977}, title = {Compositions of the Bamberg manuscript: Bamberg, Staatsbibliothek, lit. 115 (olim Ed. IV.6)}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Neuhause-Stuttgart}, volume = {75}, series = {CMM}, editor = {Andreson, Gordon} }——— (Hrsg.), Notre-Dame and related Conductus: Opera omnia, Henryville u.a. 1979-1988.
@book{Andreson.19791988, year = {1979-1988}, title = {Notre-Dame and related Conductus: Opera omnia}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Henryville u.a.}, editor = {Andreson, Gordon} }——— (Hrsg.), The Las Huelgas manuscript (CMM), Neuhausen-Stuttgart 1982.
@book{Andreson.1982, year = {1982}, title = {The Las Huelgas manuscript}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Neuhausen-Stuttgart}, volume = {79}, series = {CMM}, editor = {Andreson, Gordon} }Asensio, Juan Carlos, El códice de las Huelgas (Patrimonio musical español), Madrid 2001.
@book{EcdlHAsensio, author = {Asensio, Juan Carlos}, year = {2001}, title = {El c{\'o}dice de las Huelgas}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Madrid}, volume = {8}, series = {Patrimonio musical espa{\~n}ol} }Philippus de Caserta, „Tractatus de diversis figuris“ in: CS III , S. 118–124.
@incollection{PhilippusdeCaserta., author = {{Philippus de Caserta}}, title = {Tractatus de diversis figuris}, keywords = {Motette;Quellentexte}, pages = {118--124}, booktitle = {CS III} }Tischler, Hans (Hrsg.), The Montpellier Codex (Recent researches in the music of the Middle Ages and Early Renaissance), Madison 1978-1985.
@book{Tischler.19781985, year = {1978-1985}, title = {The Montpellier Codex}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Madison}, volume = {2-8}, series = {Recent researches in the music of the Middle Ages and Early Renaissance}, editor = {Tischler, Hans} }——— (Hrsg.), The earliest motets (to circa 1270): A complete comparative edition, New Haven and London 1982.
@book{Tischler.1982, year = {1982}, title = {The earliest motets (to circa 1270): A complete comparative edition}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {New Haven and London}, editor = {Tischler, Hans} }Bell, Nicholas, The Las Huelgas Music Codex: A companion study to the facsimile, Madrid 2003.
@book{TLHMCAcsttfBell, author = {Bell, Nicholas}, year = {2003}, title = {The Las Huelgas Music Codex: A companion study to the facsimile}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Madrid} }Young, Irwin (Hrsg.), Franchino Gaffori: The Practica musicae of Franchinus Gafurius, Madison 1969.
@book{Young.1969, year = {1969}, title = {Franchino Gaffori: The Practica musicae of Franchinus Gafurius}, keywords = {Motette;Quellentexte}, address = {Madison}, editor = {Young, Irwin} }
Franco von Köln: Ars cantus mensurabilis
Johannes de Muris: Notitia artis musicae
Philippe de Vitry (?): Ars nova
Philippus de Caserta: Tractatus de diversis figuris
Motette El mois d'avril/O quam sancta/Et gaudebit: Tischler 1978, Bd. 2, S. 1–4
Antonio Zacara da Teramo: Ballata Sumite karissimi : PMFC 13, S. 202–205
Baude Cordier: Rondeau Belle, bonne, sage: PMFC 18, S. 1–2
Baude Cordier: kanonische Chanson Tout par compas suy composes: PMFC 18, S. 3–6
Jakob Senleches: Virelais La harpe de mélodie: PMFC 19, S. 56–57
Guillaume de Machaut: Motette Bone pastor/Bone pastor/Bone pastor: PMFC 3, S. 4–7
Guillaume de Machaut: Motette O livoris feritas/Fons tocius superbie/Fera pessima: PMFC 3, 80–81
Motette Campanis cum cymbalis/Onoremus dominam: PMFC 14, S. 116–117
Johannes Ciconia: Motetten
Albane misse celitus/Albane doctor maxime: PMFC 24, S. 85–87
Venecie mundi splendor/Michael qui Steno domus: PMFC 24, S. 77–80
Handschriften
D-BAs lit. 115 <http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=2957869&custom_att_2=simple_viewer>
@book{DBl1, title = {D-BAs lit. 115}, url = {http://bvbm1.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?pid=2957869&custom_att_2=simple_viewer}, keywords = {Handschriften;Motette} }D-B Mus. Ms. 40613 <http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN645230707&PHYSID=PHYS_0001>
@book{DBMM4, title = {D-B Mus. Ms. 40613}, url = {http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN645230707&PHYSID=PHYS_0001}, keywords = {Handschriften;Motette} }D-Mu Cim. 100 = 2° Cod. ms. 156.
@book{DMC12Cm1, title = {D-Mu Cim. 100 = 2° Cod. ms. 156}, keywords = {Handschriften;Motette} }D-Mu Cim. 100 = 2° Cod. ms. 156.
@book{DMC12Cm1b, title = {D-Mu Cim. 100 = 2° Cod. ms. 156}, keywords = {Handschriften;Motette} }D-Mbs Mus. Ms. 3725 <http://daten.digitale-sammlungen.de/ db/0004/bsb00045513/images/>
@book{DMMM3, title = {D-Mbs Mus. Ms. 3725}, url = {http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00045513/images/}, keywords = {Handschriften;Motette} }D-ROu Mss. phil. 100/2 <http://www.rostocker-liederbuch.de>
@book{DRMp12, title = {D-ROu Mss. phil. 100/2}, url = {http://www.rostocker-liederbuch.de}, keywords = {Handschriften;Motette} }E-BUlh 9 <https://botiga.bnc.cat/?product=el-codex-musical-de-las-huelgas-musica-a-veus-dels-segles-xiii-xiv-volum-ii-facsimil>
@book{EB9b, title = {E-BUlh 9}, url = {https://botiga.bnc.cat/?product=el-codex-musical-de-las-huelgas-musica-a-veus-dels-segles-xiii-xiv-volum-ii-facsimil}, keywords = {Handschriften;Motette} }E-MO Llibre Vermell <http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/08140629733581728654480/index.htm>
@book{EMLV, title = {E-MO Llibre Vermell}, url = {http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/08140629733581728654480/index.htm}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-CH 564.
@book{FC5, title = {F-CH 564}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-CH MS 564 <https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=15953>
@book{FCM5, title = {F-CH MS 564}, url = {https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?reproductionId=15953}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-MOf H 196 <https://manuscrits.scdi-montpellier.fr/vignettem.php?GENRE[]=MP&ETG=OR&ETT=OR&ETM=OR&BASE=manuf>
@book{FMH1b, title = {F-MOf H 196}, url = {https://manuscrits.scdi-montpellier.fr/vignettem.php?GENRE[]=MP&ETG=OR&ETT=OR&ETM=OR&BASE=manuf}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-Pn f. fr. 146 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f104.item>
@book{FPff1c, title = {F-Pn f. fr. 146}, url = {https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454675g/f104.item}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-Pn lat. 15139 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139>
@book{FPl1h, title = {F-Pn lat. 15139}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432457p/f1.image.r=15139}, keywords = {Handschriften;Motette} }F-Pn n.a. 13521.
@book{FPna1b, title = {F-Pn n.a. 13521}, keywords = {Handschriften;Motette} }GB-Lbm add. 27630.
@book{GLa2c, title = {GB-Lbm add. 27630}, keywords = {Handschriften;Motette} }GB-Ob Mus. c. 60.
@book{GOMc6, title = {GB-Ob Mus. c. 60}, keywords = {Handschriften;Motette} }GB-Ob MS. Lat. liturg. d. 20.
@book{GOMLld2, title = {GB-Ob MS. Lat. liturg. d. 20}, keywords = {Handschriften;Motette} }I-MOe \textgreeka.M.5.24 <http://www.examenapium.it/meri/sumite.htm>
@book{IMM52, title = {I-MOe \textgreek{a}.M.5.24}, url = {http://www.examenapium.it/meri/sumite.htm}, keywords = {Handschriften;Motette} }I-Tn J. II. 9 <http://ntcredazione.sbn.it/upload/sfogliatori/franco-cip/francocip.jsp>
@book{ITJI9, title = {I-Tn J. II. 9}, url = {http://ntcredazione.sbn.it/upload/sfogliatori/franco-cip/francocip.jsp}, keywords = {Handschriften;Motette} }S-Uu C 233 4°.
@book{SUC24, title = {S-Uu C 233 4°}, keywords = {Handschriften;Motette} }US-Cn Ms. 54.1.
@book{UCM51, title = {US-Cn Ms. 54.1}, keywords = {Handschriften;Motette} }
Faksimilia
Anglès, Higini (Hrsg.), El Còdex musical de Las Huelgas (música a veus dels segles XIII–XIV), Introducció, Facsímil i Transcripció, Barcelona 1931.
@book{Angles.1931, year = {1931}, title = {El C{\`o}dex musical de Las Huelgas (m{\'u}sica a veus dels segles XIII--XIV), Introducci{\'o}, Facs{\'i}mil i Transcripci{\'o}}, keywords = {Faksimilia;Motette}, address = {Barcelona}, editor = {Angl{\`e}s, Higini} }Aubry, Pierre (Hrsg.), Cent Motets du XIIIe siècle publiés d’après le Manuscrit Ed. IV.6 de Bamberg, Paris 1908.
@book{Aubry.1908, year = {1908}, title = {Cent Motets du XIIIe si{\`e}cle publi{\'e}s d'apr{\`e}s le Manuscrit Ed. IV.6 de Bamberg}, keywords = {Faksimilia;Motette}, address = {Paris}, editor = {Aubry, Pierre} }Gennrich, Friedrich (Hrsg.), Die Sankt Viktor-Clausulae und ihre Motetten, Darmstadt 1953.
@book{Gennrich.1953, year = {1953}, title = {Die Sankt Viktor-Clausulae und ihre Motetten}, keywords = {Faksimilia;Motette}, address = {Darmstadt}, editor = {Gennrich, Friedrich} }Rokseth, Yvonne (Hrsg.), Polyphonies du XIIIe siècle, Paris 1936-1939.
@book{Rokseth.19361939, year = {1936-1939}, title = {Polyphonies du XIIIe si{\`e}cle}, keywords = {Faksimilia;Motette}, address = {Paris}, editor = {Rokseth, Yvonne} }
Literatur
Andreson, Gordon, „The notation of the Bamberg and Las Huelgas Manuscripts“ in: Musica disciplina 32, 1978, S. 19–67.
@article{Andreson.1978, author = {Andreson, Gordon}, year = {1978}, title = {The notation of the Bamberg and Las Huelgas Manuscripts}, keywords = {Literatur;Motette}, pages = {19--67}, volume = {32}, journal = {Musica disciplina} }Leech-Wilkinson, Daniel, Compositional techniques in the fourt-part isorhythmic motets of Philippe de Vitry and his contemporaries, New York 1989.
@book{CtitfpimoPdVahcLeechWilkinson, author = {Leech-Wilkinson, Daniel}, year = {1989}, title = {Compositional techniques in the fourt-part isorhythmic motets of Philippe de Vitry and his contemporaries}, keywords = {Literatur;Motette}, address = {New York} }Frobenius, Wolf, „Zum genetischen Verhältnis zwischen Notre Dame-Klauseln und ihren Motetten“ in: Archiv für Musikwissenschaft 44, 1987, S. 1–39.
@article{Frobenius.1987, author = {Frobenius, Wolf}, year = {1987}, title = {Zum genetischen Verh{\"a}ltnis zwischen Notre Dame-Klauseln und ihren Motetten}, keywords = {Literatur;Motette}, pages = {1--39}, volume = {44}, journal = {Archiv f{\"u}r Musikwissenschaft} }Körndle, Franz, „Von der Klausel zur Motette und zurück?“ in: Musiktheorie 25, 2010, S. 117–128.
@article{Korndle.2010b, author = {K{\"o}rndle, Franz}, year = {2010}, title = {Von der Klausel zur Motette und zur{\"u}ck?}, keywords = {Literatur;Motette}, pages = {117--128}, volume = {25}, journal = {Musiktheorie} }Levy, Kenneth, „New material on the early motet in England“ in: Journal of the American Musicological Society 4, 1951, S. 220–239.
@article{Levy.1951, author = {Levy, Kenneth}, year = {1951}, title = {New material on the early motet in England}, keywords = {Literatur;Motette}, pages = {220--239}, volume = {4}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Hofmann, Klaus, Untersuchungen zur Kompositionstechnik der Motette im 13. Jahrhundert, durchgeführt an Motetten mit dem Tenor IN SECULUM, Neuhausen-Stuttgart 1972.
@book{UzKdMi1JdaMmdTISHofmann, author = {Hofmann, Klaus}, year = {1972}, title = {Untersuchungen zur Kompositionstechnik der Motette im 13. Jahrhundert, durchgef{\"u}hrt an Motetten mit dem Tenor IN SECULUM}, keywords = {Literatur;Motette}, address = {Neuhausen-Stuttgart} }Zimei, Francesco (Hrsg.), Antonio Zacara da Teramo e il suo tempo, Lucca 2004.
@book{Zimei.2004, year = {2004}, title = {Antonio Zacara da Teramo e il suo tempo}, keywords = {Literatur;Motette}, address = {Lucca}, editor = {Zimei, Francesco} }
Audio/Video:
Jakob Senleches: Virelais La harpe de mélodie (mit Faksimile):
Mehrstimmige Vertonungen des Messordinariums im 14. Jahrhundert
Neben vielen anonymen Komponisten finden sich im Codex Ivrea auch identifizierte Kompositionen von Philippe de Vitry, vor allem seine späten Motetten, und drei Motetten und ein Rondeau von Guillaume de Machaut. Im Codex Apt sind Kompositionen u.a. von Baude Cordier (Gloria), Johannes Tapissier /(Jean de Noyers) (Credo) und Pierre Tailhandier (Credo), mit teilweiser Parallelüberlieferung in der zwischen 1420 und 1435 in einem musikliebenden Kreis um Pietro Emiliani, Bischof von Vicenza, in Italien kompilierten Handschrift I-Bc Q 15 <http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q015/>, die auch eine der Hauptquellen für die Überlieferung zu Ciconia und Guillaume Dufay darstellt, enthalten.
Bsp.: Von den dreistimmigen Messen von Tournai (B-Tc [Tournai, Bibliothèque du Chapitre] 476, f. 28–33v), F-TLm 94 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105600662>, Barcelona (E-Bbc [Biblioteca de Catalunya] Ms. 971), Besançon/Sorbonne (F-Pim [Institut de Musicologie de la Sorbonne] s.s.) sei hier stellvertretend die Messe de Tournai (Edition: Dumoulin 1988 Audio/Video) etwas näher betrachtet: Die Handschrift wird in der Kathedrale von Tournai aufbewahrt und enthält die älteste der vier Messen, entstanden im 2. Viertel des 14. Jahrhunderts. Sie enthält die fünf Ordinariums-Sätze und das Ite missa est, das im 14. Jahrhundert mit zum Ordinarium gezählt wurde, und war vermutlich als Marienmesse gedacht. Die Marienverehrung hatte in Tournai eine lange Tradition und die Handschrift enthält auch sonst einstimmige Mariengesänge. Das Credo der Messe ist ebenfalls in Codex Apt und im Codex Las Huelgas, das Ite missa est auch in Ivrea überliefert, so dass sich deutliche Verbindungen zur Tradition aus Avignon zeigen. Offenbar handelt es sich um eine Kompilation, da die einzelnen Sätze stilistisch sehr unterschiedlich vertont sind: Kyrie, Sanctus und Agnus Dei zeigen einen sehr archaischen Stil, der ganz im 4. rhythmischen Modus gehalten ist und ausschließlich Longen und Breven verwendet. Dies führt zu einem sehr blockhaften, gegenüber den anderen Sätzen sehr schwerfälligen Klangbild, das an den Stil des 13. Jahrhunderts erinnert. Tenor und Motetus bilden Klangfortschreitungen der Art 5->3->1, 1->3->5 und 5->3->5 in Gegenbewegung, die vom Triplum zu Quint-Oktav-Klängen ergänzt werden, manchmal aber auch mit Terz-Sext-Klängen durchsetzt sind und damit auf den Fauxbourdon des 15. Jahrhunderts vorausweisen. Auffällig sind die immer gleichen Schlusskadenzen. Die neunte Anrufung des Kyrie ist extra vertont, Sanctus und Agnus wirken etwas aufgelockerter als das Kyrie und enthalten auch melismatische Partien im motettischen Stil, wobei der Tenor im 5. rhythmischen Modus gehalten ist. Das Gloria zeigt das typische Bild der Ars nova-Motette, mit tempus perfectum, ruhig gehaltenem Tenor und lebendigen Oberstimmen in rascher Figuration. Formal weist der Satz allerdings eher Merkmale des Conductus auf, denn alle Stimmen sind textiert und kadenzieren gemeinsam bei Sinneinheiten und Binnenkadenzen, und die Komposition schließt mit einem ausgedehnten Amen mit großen Hoketus-Partien. Das Credo ist ruhiger als das Gloria gehalten und weist, bedingt durch den langen Text, eine stark homorhythmische Faktur auf. Das Triplum, das die Choralintonation fortführt, erscheint als melodisch führende Stimme mit zwei tieferen Begleitstimmen. Einzelne Glaubensartikel sind nicht besonders herausgehoben, nur der Schluss wird wie im Gloria durch ein ausgedehntes Melisma über Amen markiert. Das Ite missa est ist als dreistimmige isorythmische Motette mit dem Triplum Se grace n´est und dem Duplum Cum venerint gestaltet, die auch unabhängig in anderen Handschriften überliefert ist: Der Tenor weist zwei colores mit jeweils drei taleae auf, wobei die dritte talea unvollständig ist. Der Motetus trägt einen lateinischen Fürbitt-Text, das Triplum einen französischen Liebestext, wobei die Anrede ma dame in der typischen Doppeldeutigkeit der Motette weltlich wie religiös interpretierbar ist. Auffallend an der Messe de Tournai sind die zweitaktigen Zwischenglieder ohne Text im Gloria und Credo. Die verschiedenen Modi der Sätze (Kyrie: Mixolydisch, Gloria: Lydisch, Credo: Dorisch, Agnus und Sanctus: Lydisch) und ihre stilistische Unterschiedlichkeit legen nahe, dass die Messeteile nicht von vorne herein zusammen verfasst wurden, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sind. Trotzdem wurden die Sätze offenbar als Zyklus verstanden und so gehört. Die von der früheren Forschung vertretene Meinung, dass erst bei der Verbindung aller Messesätze mit musikalischen Mitteln wirklich von einem Zyklus gesprochen werden kann, stellt also eher eine Projektion der Wissenschaftsgeschichte als die zeitgenössische Auffassung dar.
Guillaume de Machauts , Messe de Nostre Dame ist offenbar unabhängig von der südfranzösischen Tradition entstanden, allerdings sind viele Gemeinsamkeiten mit der Messe de Tournai auffällig. Leonel Power scheint sich wiederum in einem vierstimmigen im Old Hall Manuscript (GB-Lbl add. 57950) überlieferten Sanctus, dem wie bei Machaut das Sanctus XVII zugrunde liegt, auf Machauts Messe zu beziehen. Machauts Messe erscheint als Teil seines Gesamtschaffens, das er unter die von Dame nature an ihn heran getragene Aufforderung stellt, dem Ruhm von amour zu dienen. Die Messe ist in vier Handschriften der Pariser Bibliothèque nationale überliefert (F-Pn f. fr. 1584, f. 438-451; F-Pn f. fr. 1585, f. 281v-294r; F-Pn f. fr. 9221, f. 164v-170; F-Pn f. fr. 25546, f. 125v-133v) und trägt nur in der Handschrift Vogüé (US-KAferrell [Ferrell-Vogüé Manuscript, Private Collection of James E. and Elizabeth J. Ferrell, momentan in GB-Ccc], f. 283v) den Titel Messe de Nostre dame.
Nach Ausweis des Zeichens ».III.« in den Handschriften sind die Rufe des Kyrie jeweils dreimal mehrstimmig und nicht alternatim mit der einstimmigen Choralfassung auszuführen. Die Abschnitte I–IV des Gloria sind in sich jeweils dreigeteilt mit gleichem Kadenzschema durch ouvert- und clos-Schluss. Auffällig ist die zweimalige, durch lange Notenwerte markierte Heraushebung von Ihesu Christe in duplex longa-Zeichen wie schon beim einleitenden Et in terra pax, ebenso die identischen kurzen Floskeln, die an eine Art »Zwischenspiel« erinnern, und ähnlich bereits in der Messe de Tournai vorhanden waren. Das Credo weist Verwandtschaften mit demjenigen der Tournai-Messe auf: Hier wie dort führt das Triplum nach der nicht notierten einstimmigen Intonation die Choralmelodie von Credo I mit e–f–e–d–c eine Quinte höher weiter, und es sind zwischenspielartige melodische Floskeln zu beobachten, die im Unterschied zum Gloria aber immer verschieden sind. Agnus I ist in 2 taleae à 12 Noten + Finalis, Agnus II in 6 taleae à 4 Noten + Finalis gegliedert. Durch diese Einteilung der taleae werden die im cantus firmus identischen Abschnitte in Agnus I und II rhythmisch unterschiedlich gegliedert.
Im Old Hall Manuscript (GB-Lbm Add. Ms. 57950 <https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001r> verdienen je zwei Paare von Gloria/Credo (Gloria Nr. 21, f. 16v-17 und Credo Nr. 77, f. 64v-65; Edition CMM 46 I, S. 40-44, 217-222; Gloria Nr. 24, 19v-20 [in der Handschrift ohne Komponistenangabe] und Credo Nr. 84, f. 71v-72; Edition CMM 46 I, S. 55-60, 264-270) und Sanctus/Agnus (Sanctus Nr. 116, f. 94v-95 und Agnus Nr. 140, f. 107 [in der Handschrift ohne Komponistenangabe]; Edition CMM 46 I, S. 350-352, 399-401; Sanctus Nr. 118, f. 96v-97 und Agnus Nr. 141, f. 107v-108; Edition CMM 46 I, S. 357-360, 402-404) von Leonel Power besondere Aufmerksamkeit. Sie bilden frühe Zeugnisse dafür, die Messesätze musikalisch zu verbinden und später alle Sätze durch denselben cantus firmus zum Messezyklus zu formen. Hierzu gehört auch ein zweistimmiges Sanctus-Agnus-Paar in der Handschrift I-Bc (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale), Q 11 aus dem frühen 14. Jahrhundert. Offenbar wurden aber auch nicht ursprünglich als Zyklus konzipierte Messesätze für den Gebrauch ad hoc zusammengestellt.
In der Handschrift I-Bc Q 15 ist ein Gloria von Antonio Zacara da Teramo mit dem Zusatz »anglicana« eingetragen (f. 179v–180r. Der Zusatz könnte auf die Verwendung von Terzklängen, wie etwa bei »Quoniam« (f - c - a in Tenor, Contratenor und Cantus), hinweisen, die im 15. Jahrhundert auf dem Kontinent als Charakteristika einer spezifisch englischen Klanglichkeit wahrgenommen werden.
Aus dem italienischen Trecento sind von Gherardello da Firenze ein Gloria (f. 131v–133r) und ein Agnus (f. 137v, Edition CMM 8/i, S. 53–55, 55–56), von Bartholus da Firenze ein Credo (f. 133v–136r, Edition CMM 8/i, S. 1–6), von Lorenzo da Firenze ein Sanctus (f. 136v–137r) und von Paolo da Firenze (um 1355 bis um 1436) ein dreistimmiges Benedicamus Domino (f. 138r) in der italienischen Handschrift F-Pn f. it. 568 erhalten. Sie wurden offenbar dort zu einem Messordinarium zusammengestellt, obwohl sie stilistisch sehr heterogene Merkmale aufweisen. Einen Sonderfall bildet die Umarbeitung von Francesco Landinis bekannter Ballata Questa fanciull´amor zu einem Kyrie (D-Mbs Clm 14274, Codex St. Emmeram f. 58v) und Agnus Dei (I-Gua [Codex Nr. 1 Guardiagrele, Chiesa di S. Maria Maggiore], f. 192v). Von Antonio Zacara da Teramo (Antonius Berardi) (um 1350, gest. um 1413/1416), der von 1391 bis 1407 als der Sänger, Komponist und Schreiber Çacherias in päpstlichen Diensten stand und noch 1413 in den Besoldungslisten Papst Johannes XXIII. erscheint, sind sechs teilweise groß angelegte Gloria- und Credo-Sätze erhalten, die zumindest in der Zusammenstellung zu Paaren in I-Bc Q 15 <http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q015/> auf die bereits in der englischen Überlieferung zu beobachtenden Anfänge der Zyklus-Bildung verweisen. Von Matteo da Perugia (Mailand, frühes 15. Jahrhundert) sind in der Handschrift I-MOe (Modena, Bibl. Estense) α.M.5.24 sieben Gloria-Sätze, darunter ein dreistimmiges Gloria mit virtuoser Oberstimmengestaltung und ein tropiertes Gloria Spiritus et alme, sowie zwei Credo-Sätze und von Philippus de Caserta ein Credo zu nennen. Diesen Kompositionen liegt meist ein Tenor-Contratenor-Gerüst, teilweise in kanonischer Führung, zugrunde, worin vor allem beim Gloria und Sanctus ein Abbild des sine fine und una voce der Engelschöre zu sehen sein könnte. Die virtuose Oberstimmengestaltung mit typischen Kolorierungen verweist auf das Madrigal und einige Gloria-Sätze von Zacara de Teramo basieren sogar in Vorwegnahme der Parodietechnik des 16. Jahrhunderts auf seinen eigenen weltlichen Kompositionen, wie z.B. auf seiner Ballata Rosetta che non cambi mai colore .
Johannes Ciconias tropiertes Gloria Suscipe trinitas , das um eine Beendigung des Schismas bittet, könnte mit einiger Wahrscheinlichkeit aus Ciconias Zeit in Rom stammen.
Quellen
Codex Ivrea: I-IV (Ivrea, Biblioteca capitolare), Ms. 115
Codex Apt: F-APT (Apt, Cathédrale Saint-Anne, Bibliothèque du chapitre), Ms. 16bis
Handschriften
B-Tc 476.
@book{BT4, title = {B-Tc 476}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }E-Bbc Ms. 971.
@book{EBM9, title = {E-Bbc Ms. 971}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }F-APT Ms. 16bis.
@book{FAM1, title = {F-APT Ms. 16bis}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }F-Pn f. it. 568 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84490281>
@book{FPfi5b, title = {F-Pn f. it. 568}, url = {http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84490281}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }F-TLm 94 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105600662>
@book{FT9, title = {F-TLm 94}, url = {https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105600662}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }GB-Lbm Add. Ms. 57950 <https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001r>
@book{GLAM5, title = {GB-Lbm Add. Ms. 57950}, url = {https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_57950_fs001r}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }I-Bc Q 15 <http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q015/>
@book{IBQ1, title = {I-Bc Q 15}, url = {http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q015/}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }I-IV Ms. 115.
@book{IIM1, title = {I-IV Ms. 115}, keywords = {Handschriften;mehrstimmigeVertonungen} }
Faksimilia
Gennrich, Friedrich (Hrsg.), Guillaume de Machaut: La messe de Nostre-Dame (Summa musicae medii aevi), Langen bei Frankfurt 1957.
@book{Gennrich.1957, year = {1957}, title = {Guillaume de Machaut: La messe de Nostre-Dame}, keywords = {Faksimilia;mehrstimmigeVertonungen}, address = {Langen bei Frankfurt}, volume = {1}, series = {Summa musicae medii aevi}, editor = {Gennrich, Friedrich} }
Quellentexte und Editionen
Johannes Tinctoris: Terminorum musicae diffinitorium
Bent, Margaret (Hrsg.), Bologna Q15: The making and remaking of a musical manuscript. Introductory study and facsimile, Lucca 2008.
@book{Bent.2008, year = {2008}, title = {Bologna Q15: The making and remaking of a musical manuscript. Introductory study and facsimile}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Lucca}, editor = {Bent, Margaret} }Billet, Frédéric (Hrsg.), La messe de la Sorbonne, Paris 2011.
@book{Billet.2011, year = {2011}, title = {La messe de la Sorbonne}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Paris}, editor = {Billet, Fr{\'e}d{\'e}ric} }Dumoulin, Jean (Hrsg.), La messe de Tournai. Une messe polyphonique en l’honneur de Notre-Dame à la cathédrale de Tournai au XIV siècle, Tournai 1988.
@book{Dumoulin.1988, year = {1988}, title = {La messe de Tournai. Une messe polyphonique en l'honneur de Notre-Dame {\`a} la cath{\'e}drale de Tournai au XIV si{\`e}cle}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Tournai}, editor = {Dumoulin, Jean} }Fischer, Kurt von und F. Alberto Gallo (Hrsg.), Italian sacred music (PMFC), Monaco 1976.
@book{Fischer.1976, year = {1976}, title = {Italian sacred music}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Monaco}, volume = {12}, series = {PMFC}, editor = {von Fischer, Kurt and Gallo, F. Alberto} }——— (Hrsg.), Italian sacred and ceremonial music (PMFC), Monaco 1987.
@book{Fischer.1987, year = {1987}, title = {Italian sacred and ceremonial music}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Monaco}, volume = {13}, series = {PMFC}, editor = {von Fischer, Kurt and Gallo, F. Alberto} }Harrison, Frank Ll. u. a. (Hrsg.), English music for mass and offices (PMFC), Paris and Monaco 1983-1986.
@book{Harrison.19831986, year = {1983-1986}, title = {English music for mass and offices}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Paris and Monaco}, volume = {16-17}, series = {PMFC}, editor = {Harrison, Frank Ll. and Sanders, Ernest H. and Lefferts, Peter M.} }Leech-Wilkinson, Daniel (Hrsg.), Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame, Oxford 1990.
@book{LeechWilkinson.1990, year = {1990}, title = {Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Oxford}, editor = {Leech-Wilkinson, Daniel} }Ludwig, Friedrich (Hrsg.), Guillaume de Machaut. Musikalische Werke, Bd. 4: Messe und Lais, Leipzig 1943.
@book{Ludwig.1943, year = {1943}, title = {Guillaume de Machaut. Musikalische Werke, Bd. 4: Messe und Lais}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Leipzig}, editor = {Ludwig, Friedrich} }Schrade, Leo (Hrsg.), The Works of Guillaume de Machaut (PMFC), Monaco 1956.
@book{Schrade.1956c, year = {1956}, title = {The Works of Guillaume de Machaut}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Monaco}, volume = {3}, series = {PMFC}, editor = {Schrade, Leo} }Stäblein-Harder, Hanna (Hrsg.), Fourteenth century mass music in France (CMM; MSD), Rom 1962.
@book{StableinHarder.1962, year = {1962}, title = {Fourteenth century mass music in France}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Rom}, volume = {29; 7}, series = {CMM; MSD}, editor = {St{\"a}blein-Harder, Hanna} }van den Borren, Charles (Hrsg.), Missa Tornacensis (CMM), Rom 1957.
@book{vandenBorren.1957, year = {1957}, title = {Missa Tornacensis}, keywords = {mehrstimmigeVertonungen;Quellentexte}, address = {Rom}, volume = {13}, series = {CMM}, editor = {{van den Borren}, Charles} }
Literatur
Chailley, Jacques, „La Messe de Besançon et un compositeur inconnu du XIV\^e\^ siècle, Jean Lambelet“ in: Annales musicologiques. Moyen Âge et Renaissance, II , Paris 1954, S. 93–103.
@incollection{Chailley.1954, author = {Chailley, Jacques}, title = {La Messe de Besan{\c{c}}on et un compositeur inconnu du XIV{\^{}}e{\^{}} si{\`e}cle, Jean Lambelet}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {93--103}, booktitle = {Annales musicologiques. Moyen {\^A}ge et Renaissance, II}, year = {1954}, address = {Paris} }Gossett, Philip, „Techniques of unification in early cyclic masses and mass pairs“ in: Journal of the American Musicological Society 19, 1966, S. 205–231.
@article{Gossett.1966, author = {Gossett, Philip}, year = {1966}, title = {Techniques of unification in early cyclic masses and mass pairs}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {205--231}, volume = {19}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Harder, Hanna, „Die Messe von Toulouse“ in: Musica disciplina 7, 1953, S. 105–128.
@article{Harder.1953, author = {Harder, Hanna}, year = {1953}, title = {Die Messe von Toulouse}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {105--128}, volume = {7}, journal = {Musica disciplina} }Kirkman, Andrew, „The invention of the cyclic mass“ in: Journal of the American Musicological Society 54, 2001, S. 1–47.
@article{Kirkman.2001, author = {Kirkman, Andrew}, year = {2001}, title = {The invention of the cyclic mass}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {1--47}, volume = {54}, journal = {Journal of the American Musicological Society} }Körndle, Franz, „Die Bulle \textquotedblDocta sanctorum\textquotedbl. Überlieferung, Textgestalt und Wirkung“ in: Die Musikforschung 63, 2010, S. 147–165.
@article{Korndle.2010, author = {K{\"o}rndle, Franz}, year = {2010}, title = {Die Bulle {\textquotedbl}Docta sanctorum{\textquotedbl}. {\"U}berlieferung, Textgestalt und Wirkung}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {147--165}, volume = {63}, journal = {Die Musikforschung} }———, „Liturgieverständnis an der Schwelle zur Neuzeit. Die Bulle \frqqDocta sanctorum\flqq Papst Johannes’ XXII und ihre Anwendung“ in: Klaus Pietschmann (Hrsg.), apsttum und Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu Benedikt XVI. Positionen - Entwicklungen - Kontexte (Analecta musicologica), Kassel u.a. 2012.
@incollection{Korndle.2012, author = {K{\"o}rndle, Franz}, title = {Liturgieverst{\"a}ndnis an der Schwelle zur Neuzeit. Die Bulle {\frqq}Docta sanctorum{\flqq} Papst Johannes' XXII und ihre Anwendung}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, series = {Analecta musicologica}, editor = {Pietschmann, Klaus}, booktitle = {apsttum und Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu Benedikt XVI. Positionen - Entwicklungen - Kontexte}, year = {2012}, address = {Kassel u.a.} }Mouchet, Florence, „La décrétale Docta sanctorum patrum de Jean XXII et l’Ars nova dans le Midi: vers une définition du corpus musical concerné“ in: Michelle Fournié (Hrsg.), Jean XXII et le Midi , Toulouse 2012.
@incollection{Mouchet.2012, author = {Mouchet, Florence}, title = {La d{\'e}cr{\'e}tale Docta sanctorum patrum de Jean XXII et l'Ars nova dans le Midi: vers une d{\'e}finition du corpus musical concern{\'e}}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, editor = {Fourni{\'e}, Michelle}, booktitle = {Jean XXII et le Midi}, year = {2012}, address = {Toulouse} }Schrade, Leo, „The mass of Toulouse“ in: Revue belge de musicologie 8, 1954, S. 84–96.
@article{Schrade.1954, author = {Schrade, Leo}, year = {1954}, title = {The mass of Toulouse}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {84--96}, volume = {8}, journal = {Revue belge de musicologie} }Stephan, Rudolf, „Das Schlußstück der \frqqMesse von Toulouse\textquotedbl“ in: Werner Breig (Hrsg.), Analysen. Beiträge zu einer Problemgeschichte des Komponierens. Festschrift Hans Heinrich Eggebrecht zum 65. Geburtstag , Stuttgart 1984, S. 40–45.
@incollection{Stephan.1984, author = {Stephan, Rudolf}, title = {Das Schlu{\ss}st{\"u}ck der {\frqq}Messe von Toulouse{\textquotedbl}}, keywords = {Literatur;mehrstimmigeVertonungen}, pages = {40--45}, editor = {Breig, Werner}, booktitle = {Analysen. Beitr{\"a}ge zu einer Problemgeschichte des Komponierens. Festschrift Hans Heinrich Eggebrecht zum 65. Geburtstag}, year = {1984}, address = {Stuttgart} }
Instrumente in Liturgie und Kirche
Kaiser Konstantin Kopronymos schenkt 757 Pippin dem Jüngeren eine kleine Orgel und Karl dem Großen wird 812 in Aachen von einer Gesandtschaft aus Konstantinopel mit einer Wasserorgel (Hydraulis ) gehuldigt, die einem Bericht Notkers v. St. Gallen zufolge von den Hofmusikern Karls als Balgorgel inklusive der aus Metall gegossenen Windladen nachgebaut wurde. Bei der Orgel, die 826 für Ludwig den Frommen vermutlich von einem byzantinischen Geistlichen aus Venedig gebaut wurde, handelte es sich allerdings um eine Hydraulis, wie sie im sogenannten Utrechter Psalter (NL-Uu Ms. 32) zur Illustration von Psalm 150 (f. 83r) und auf dem letzten Folio (f. 91v) dargestellt ist. Schrift- und Bildquellen dokumentieren zudem Doppelorgeln, die auf eine Bordunpraxis rückschließen lassen. Der Traktat von Theophilus Presbyter beschreibt auch die Herstellung von Orgelpfeifen aus Kupfer. Archäologische Orgelfunde aus Byzanz liegen nicht vor, wohl aber aus der römischen Antike aus Aquincum (Budapest) und Aventicum (Avenches ). Der gut erhaltene Fund von Aquincum ist auf 228 n. Chr. datiert und besaß 52 Pfeifen in vier Registern zu je 13 Pfeifen, ein Register gedackt, die anderen offen. Für das 9. Jahrhundert sind Orgeln in der Abtei St. Savan/Poitou , im Kloster Weihenstephan und am päpstlichen Hof in Rom belegt. Aus dem Jahr 951 stammt der Bericht des Wulfstan von Winchester über eine große Orgel aus Winchester, die 400 Pfeifen mit 26 Bälgen besessen haben soll. Weitere Belege aus dem 10. Jahrhundert sind u.a. für die Bischofssitze und Klöster Köln, Sens, Reims, Petershausen , Essen-Werden, Canterbury und Glastonbury erhalten, im 11. Jahrhundert für Osnabrück , Halberstadt , Erfurt und Weltenburg . Im 12. Jahrhundert werden Orgeln anlässlich des Hoftages von Kaiser Friedrich Barbarossa 1184 in Mainz und für Magdeburg , Salem und Konstanz erwähnt. Im 13. Jahrhundert mehren sich dann die Nachweise für Orgeln in (freien) Reichsstädten, so für Lübeck , Wetzlar und Straßburg. Im 14. Jahrhundert sind für weitere Orte herrschaftlicher Repräsentation wie Frankfurt am Main , Nürnberg und München und für die Bischofssitze Halberstadt und Magdeburg Orgeln belegt.
Das in der »Bibel des Stephen Harding« (F-Dm Ms. 14 <http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/img-viewer/MS00014/iipviewer.html?ns=FR212316101_CITEAUX_MS00014_000_01_PS.jpg&nd=&np=&cv=true&book-nb=false&bnd=FR212316101%5C_CITEAUX%5C_MS00014%5C_206%5C_PF.jpg&bnp=FR212316101%5C_CITEAUX%5C_MS00014%5C_000%5C_01%5C_PS.jpg&base=mets&monoid=MS00014&mname=&treq=&vcontext=mets&prev=book%5C>, f.14v) abgebildete Orgelinstrument belegt mit seiner auf C beginnenden Buchstabenreihe die alte, auch in Traktaten zur Orgelmensur beschriebene Tradition, dass Orgeln mit dem Ton C beginnen. Auch Reste gotländischer Orgeln des 14. und frühen 15. Jahrhunderts weisen übereinstimmend sowohl in Klaviatur wie im Pedal die auf C basierende Leiter auf. Zahlreiche Orgelintavolierungen des 15. Jahrhunderts zeigen ebenfalls in der Unterscheidung der Oktavlagen deutlich, dass die C-Leiter oder die den Hexachordraum umspielende H-Oktav das Bezugssystem bildet.
Eine der ältesten heute noch spielbaren Orgeln ist in der Valeriakirche von Sitten/Sion erhalten. Sie stammt von 1430, geht aber auf ein Vorgängerinstrument von 1390 zurück.
Quellen
I-FZc 117 <http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/contenuto/musica/bonadies/index.html>
Handschriften
F-Dm Ms. 15.
@book{FDM1, title = {F-Dm Ms. 15}, keywords = {Handschriften;InstrumenteInLiturgie} }I-FZc 117 <http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/contenuto/musica/bonadies/index.html>
@book{IF1b, title = {I-FZc 117}, url = {http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/contenuto/musica/bonadies/index.html}, keywords = {Handschriften;InstrumenteInLiturgie} }NL-Uu Ms. 32 <https://psalter.library.uu.nl/>
@book{NUM3, title = {NL-Uu Ms. 32}, url = {https://psalter.library.uu.nl/}, keywords = {Handschriften;InstrumenteInLiturgie} }
Quellentexte
Brepohl, Erhard (Hrsg.), Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk: Gesamtausgabe der Schrift De diversis artibus in einem Band, Köln u. a. 2013.
@book{Brepohl.2013, year = {2013}, title = {Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk: Gesamtausgabe der Schrift De diversis artibus in einem Band}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Quellentexte}, address = {K{\"o}ln u. a.}, editor = {Brepohl, Erhard} }Gilby, Thomas (Hrsg.), St. Thomas Aquinas: Summa theologiae. Latin text and English translation, Cambridge 2006.
@book{Gilby.2006, year = {2006}, title = {St. Thomas Aquinas: Summa theologiae. Latin text and English translation}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Quellentexte}, address = {Cambridge}, editor = {Gilby, Thomas} }
Literatur
Bittermann, Helen Robbins, „Harun Ar-Rashid’s gift of an organ to Charlemagne“ in: Speculum 4, 1929, S. 215–217.
@article{Bittermann.1929, author = {Bittermann, Helen Robbins}, year = {1929}, title = {Harun Ar-Rashid's gift of an organ to Charlemagne}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, pages = {215--217}, volume = {4}, journal = {Speculum} }Bowles, Edmund A., „The organ in the medieval liturgical service“ in: Revue belge de musicologie 16, 1962, S. 13–29.
@article{Bowles.1962, author = {Bowles, Edmund A.}, year = {1962}, title = {The organ in the medieval liturgical service}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, pages = {13--29}, volume = {16}, journal = {Revue belge de musicologie} }Schuberth, Dietrich, Kaiserliche Liturgie. Die Einbeziehung von Musikinstrumenten, insbesondere der Orgel, in den frühmittelalterlichen Gottesdienst (Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung), Göttingen 1968.
@book{KLDEvMidOidfGSchuberth, author = {Schuberth, Dietrich}, year = {1968}, title = {Kaiserliche Liturgie. Die Einbeziehung von Musikinstrumenten, insbesondere der Orgel, in den fr{\"u}hmittelalterlichen Gottesdienst}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, address = {G{\"o}ttingen}, volume = {17}, series = {Ver{\"o}ffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft f{\"u}r Liturgieforschung} }McKinnon, James, „The tenth century organ at Winchester“ in: The Organ Yearbook 5, 1974, S. 4–19.
@article{McKinnon.1974, author = {McKinnon, James}, year = {1974}, title = {The tenth century organ at Winchester}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, pages = {4--19}, volume = {5}, journal = {The Organ Yearbook} }Rühling, Susanne, „Hörbare Vergangenheit. Nachbauten antiker und mittelalterlicher Orgeln - Ein Beitrag zur Musikarchäologie“ in: oragn - Journal für die Orgel 1, 2013, S. 31–36.
@article{Ruhling.2013, author = {R{\"u}hling, Susanne}, year = {2013}, title = {H{\"o}rbare Vergangenheit. Nachbauten antiker und mittelalterlicher Orgeln - Ein Beitrag zur Musikarch{\"a}ologie}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, pages = {31--36}, volume = {1}, journal = {oragn - Journal f{\"u}r die Orgel} }Sievers, Heinrich, „Mittelalterliche Instrumente in geistlichen Spielen“ in: Das Musikleben I, 1948, S. 254–257.
@article{Sievers.1948, author = {Sievers, Heinrich}, year = {1948}, title = {Mittelalterliche Instrumente in geistlichen Spielen}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, pages = {254--257}, volume = {I}, journal = {Das Musikleben} }Giesel, Helmut, Studien zur Symbolik der Musikinstrumente im Schrifttum der alten und der mittelalterlichen Kirche (Von den Anfängen bis zum 13. Jahrhundert) (Kölner Beiträge zur Musikforschung), Regensburg 1978.
@book{SzSdMiSdaudmKVdAbz1JGiesel, author = {Giesel, Helmut}, year = {1978}, title = {Studien zur Symbolik der Musikinstrumente im Schrifttum der alten und der mittelalterlichen Kirche (Von den Anf{\"a}ngen bis zum 13. Jahrhundert)}, keywords = {InstrumenteInLiturgie;Literatur}, address = {Regensburg}, volume = {94}, series = {K{\"o}lner Beitr{\"a}ge zur Musikforschung} }
Orte liturgischer Musik
Quellen/Links
Handschriften
CH-SGs 1092 <https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/1092>
@book{CS1, title = {CH-SGs 1092}, url = {https://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/1092}, keywords = {Handschriften;OrteLiturgischerMusik} }